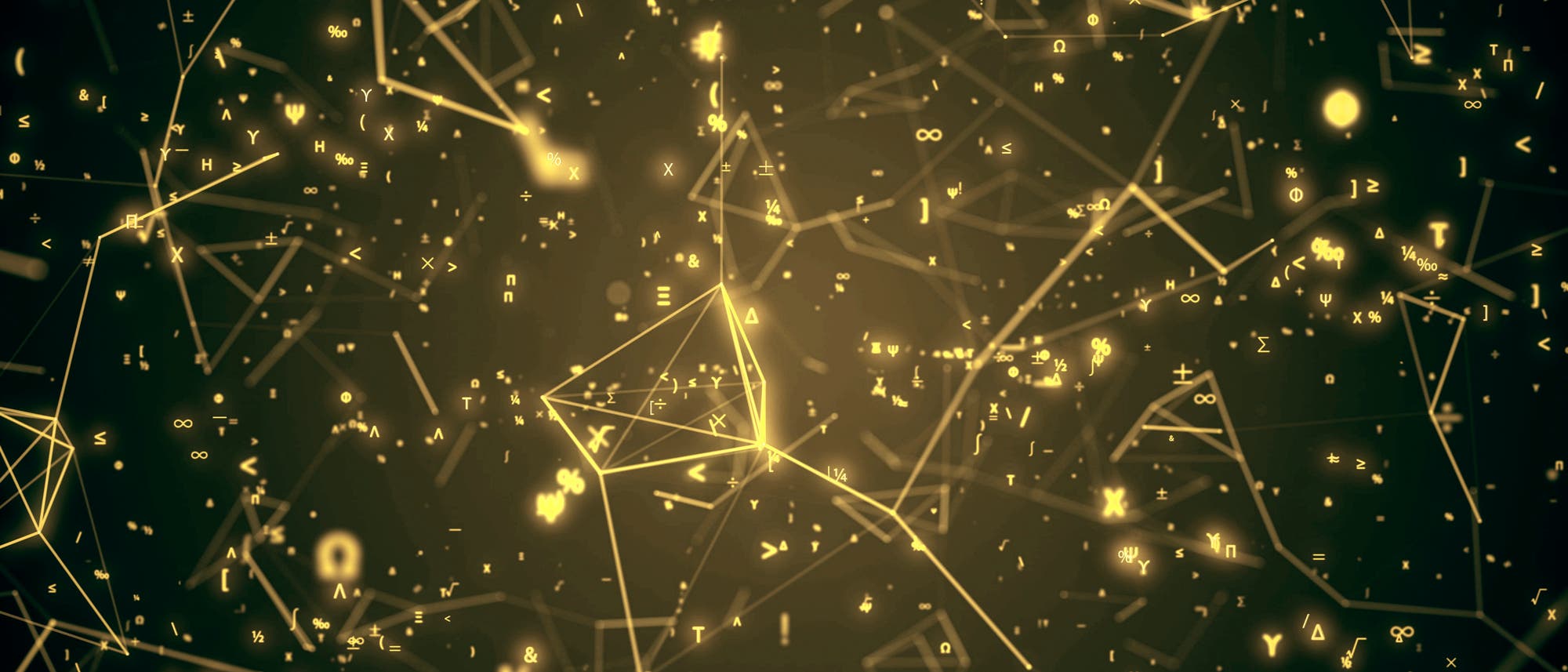Michael Sowa in Frankfurt
Stilvoll in die Apokalypse
Keiner
legt sich so elegant in die Kurve wie die Autobahnsau: Frankfurts
Museum Caricatura richtet Michael Sowa eine große Werkschau zum
achtzigsten Geburtstag aus.
Der Griff ist fest, mit dem die stämmige Frau das kleine Mädchen an diesem Sommerabend weiterzieht, weg von dem Mann mit dem wirren weißen Haar. Der hatte sich den beiden herausfordernd in den Weg gestellt und Geige gespielt, der Kasten liegt auf einer nahen Parkbank. Nun sind sie an ihm vorbei, er spielt immer noch, das linke Bein vorgestreckt, in Habitus und Kleidung noch ein Rest alter Virtuoseneleganz. Er war mal was, kein Zweifel, und wenn das die Passanten nicht erkennen, ist das nicht sein Pech. Oder erkennen sie es und eilen gerade deshalb weiter? Wer weiß, was die Frau dem Mädchen gerade erzählt, während sie so energisch an dessen Hand zerrt. Das Kind aber dreht den Kopf so weit zu dem Geiger in seinem Rücken hin, wie es anatomisch gerade noch geht. Jedes Wort der Frau, so scheint es, macht den Mann nur noch interessanter.
„Der Teufelsgeiger“ heißt das Bild, das nun im Rahmen einer großen Retrospektive zu sehen ist, die das Frankfurter Museum Caricatura dem Maler Michael Sowa zu dessen 80. Geburtstag am 1. Juli ausrichtet. 287 Exponate von mehr als 50 Leihgebern sind dort auf zwei Etagen versammelt, unten meist hängend, oben überwiegend in Vitrinen.

Dabei ergeben sich Schwerpunkte, aber keine starre Einteilung der Arbeiten: Im Erdgeschoss bündelt ein offenes Kabinett Bilder, die für Filme wie „Die fabelhafte Welt der Amélie“ entstanden sind oder die legendäre Inszenierung der „Zauberflöte“ an der Frankfurter Oper. In einem Gang hängen Wahlplakate Sowas und politische Arbeiten für das Magazin „Titanic“; die Vitrinen im ersten Stock enthalten zum großen Teil Buchcover und Illustrationen, die Sowa über die Jahre in großer Zahl schuf, etwa für die ambitionierte Haffmans-Ausgabe der Werke Karl Mays.
Dass ihr unterwegs die Luft ausging, wird man möglicherweise noch mehr um Sowas Titelbilder willen bedauern als wegen ihres Inhalts. Der Künstler, dessen Illustrationen das Kulissenhafte von Mays Schilderungen lustvoll in seine Bilder überführte, war über das Ende seiner Arbeit an der Ausgabe erleichtert. Und malte, nach eigenen Angaben „zur Entspannung“, noch ein Bild, das offensichtlich von Arno Schmidts Vermutungen zu Mays anatomisch strukturierten Landschaften inspiriert worden ist.
Auch in den übrigen Illustrationen für Bücher etwa von Axel Hacke, Max Goldt und Elke Heidenreich, Hans Magnus Enzensberger, Felicitas Hoppe und vielen anderen Autoren erweist sich Sowa als sensibler Leser, mit Sinn für Komik und Tragik gleichermaßen, etwa im Titelbild zu „Die Radiotrinkerin“ von Max Goldt, das gerade nicht die Titelheldin zeigt, sondern einen ihrer Zuhörer vor einem alten, leinenbespannten Empfänger, die Bierflasche in der Hand und, wie es von außen scheint, herzzerreißend einsam. Ob der an uns vorbeischauende Radiozuhörer sich selbst ebenso sieht, steht dahin.

Aus diesem reichen Bereich von Sowas Werk zeigt die Ausstellung naturgemäß nur einen Teil. Ein Höhepunkt dieser Abteilung ist ein noch nicht umgesetztes Projekt: die Bebilderung von Peter Hacks’ Geschichte „Pieter Welschkraut“, der sich Sowa in zahlreichen Entwürfen genähert hat. Achtmal ein Teich im Wald, Badende, beobachtet von einem Mann, jedes Mal anders und jedes Mal so, dass man sich über die Skrupel des Künstlers, sich zufriedenzugeben, nur wundern kann. Dass allerdings die variierte Wiederholung auch Sowas übrigem Werk nicht fremd ist, teilt sich in der Ausstellung sofort mit – sein Stillleben „Suppenschwein“ ist hier sowohl in einer alten Fassung wie in einer brandneuen, in diesem Jahr entstandenen und stolz einzeln präsentierten zu sehen.
Groß angelegte Ausstellungen wie diese leben davon, dass es dem Besucher überlassen bleibt, Verbindungen zwischen den einzelnen Werken zu entdecken und herzustellen. Hier sind es oft genug die wiederkehrenden Tierkörper, etwa die Schweine, die Sowa einst bei einem Freund in ländlicher Abgeschiedenheit bei Bremen studierte und seither auf seinen Bildern mit Sinn für deren Eleganz und Grazie darstellt.
Auf Postkarten ins kollektive Gedächtnis
Einige dieser Bilder sind, auch durch massenhaft verbreitete Postkarten des Künstlers, in unser kollektives Gedächtnis eingegangen, etwa die „Autobahnsau“, die sich so hinreißend energetisch und zugleich mit selbstverständlicher Leichtigkeit in die Straßenkurve legt, oder die von einer finster entschlossenen Menge aus dem trostlosen „Dödenstedt“ vertriebenen Schweine als Gegenstück der entrückt rasenden Sau.
 Hydrablicke: Michael Sowas Stillleben mit Flamingoköpfen
Hydrablicke: Michael Sowas Stillleben mit FlamingoköpfenVor allem aber zeigt die Ausstellung werkübergreifend, wie Sofa immer wieder zum – alltäglichen oder spektakulären – Ereignis auch die Reaktion der Dargestellten in den Blick nimmt. Warnt etwa ein Schild am Waldrand vor „Spinnen so groß wie Bratpfannen“, dann lenkt Sowa unsere Aufmerksamkeit auf die dreiköpfige Familie, die zwischen Unglauben, Abwehr und einer leisen Faszination changiert. Und auch unser Blick verliert sich aus der sicheren Betrachterposition im Wald: Wo sind sie nun, die Spinnen?
Beim „Ferkelrennen im Oderbruch, 1910“ frappiert die seltsame Abgebrühtheit der Zuschauer, während die Landschaft, vom zarten Himmel bis zur farbenprächtigen Blumenwiese, alles aufbietet, was man nur verlangen kann. Auf einem anderen Bild trifft das Wunder einer plüschigen neuen Straßenbahn auf zutiefst gleichgültige Benutzer, und ein schmelzendes Wohnzimmer hat genau die Bewohner, die der Bildtitel verheißt: „In bürgerlichen Kreisen bleibt man erstaunlich gelassen.“
Es sind Katastrophen mit Zuschauern, die Sowa in solchen Werken abbildet, der Kreis schließt sich zu seinen Wahlplakaten aus den Achtziger- und Neunzigerjahren, die sich auf andere Weise gegen ein „Weiter so“ wenden und fragen, wie man der Welt gegenüber nur so gleichgültig sein kann. So gesehen ist das Mädchen, das seine Neugier auf den verrufenen Teufelsgeiger nicht zügeln mag, das hinsieht, wo die zerrende Hand der Älteren das Gegenteil erzwingen will, ein Hoffnungsschimmer.