
aus spektrum.de, 31. 3. 2025 zu Ebmeiers Realien
Warum wir lachen
Jahrtausendelang
galt Lachen als ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Doch
inzwischen ist klar, dass auch Tiere dazu in der Lage sind. Jetzt
versuchen Ethologen, Primatologen und Neurowissenschaftler gemeinsam,
die Mechanismen und Funktionen dieses rätselhaften Verhaltens
aufzudecken.
von Fausto Caruana, Elisabetta Palagi und Frans B. M. de Waal
Es
gehört zu den alltäglichsten, aber auch geheimnisvollsten menschlichen
Verhaltensweisen überhaupt: Lachen. Schon seit Platons Zeiten tun sich
Philosophen und Naturforscher schwer, dieses Phänomen eindeutig dem
Geist oder dem Körper zuzuordnen, handelt es sich doch weder um eine
bewusste Aktion noch um einen bloßen körperlichen Reflex. Wir können es
zwar absichtlich vortäuschen, aber für das fingierte und das spontane
Lachen sind verschiedene Hirnareale zuständig. Daher zeigen die beiden
kleine, allerdings wesentliche Unterschiede, die Gegenstand
psychologischer Forschungen sind.
Neurologinnen
und Neurologen deuten manches Gelächter als Warnzeichen für ernste
Erkrankungen, angefangen bei Epilepsie, die von einem unkontrollierten
Lachanfall (gelastischer Anfall) eingeleitet wird, über das pathologische Lachen und Weinen
(das der Schauspieler Joaquin Phoenix als Vorbereitung auf seine Rolle
im US-Thriller »Joker« studierte) bis hin zur Kataplexie, bei der ein
spontaner Lachanfall zum kurzzeitigen Verlust des Muskeltonus und damit
zur Bewegungsunfähigkeit führen kann. Linguisten wiederum erforschen das
Lachen, um die Sprache besser zu verstehen. Denn zum einem gehorchen
beide in mancher Hinsicht ähnlichen Regeln, zum anderen könnte uns der
Vergleich des Lachens mit Tierlauten etwas über die Ursprünge
menschlicher Sprache verraten.
Auch
die Geisteswissenschaften interessieren sich für das Thema: Während
Historiker in zahlreichen Schriften zu ergründen versuchen, ob und wie
unsere Vorfahren lachten, nehmen Literaturwissenschaftler die
rhetorischen Figuren unter die Lupe, die dem Komischen zu Grunde liegen.
Wie sehr Theologen darüber debattierten, ob die Fröhlichkeit als etwas
Gutes zu betrachten sei oder nicht, hat der italienische Schriftsteller
Umberto Eco (1932–2016) in seinem berühmten Roman »Der Name der Rose«
verewigt. Darin disputiert der Benediktinermönch Jorge von Burgos (»Das
Lachen schüttelt den Körper, entstellt die Gesichtszüge und macht die
Menschen den Affen gleich«) mit dem Franziskaner William von Baskerville
(»Die Affen lachen nicht, das Lachen ist dem Menschen eigentümlich, es
ist ein Zeichen seiner Vernunft«). Kurzum, viele wissenschaftlichen
Disziplinen haben mehr oder weniger unabhängig voneinander die Frage
gestellt, warum wir lachen und welche Funktion dieses seltsame Verhalten
erfüllt.
Im
Lauf der letzten zwei Jahrtausende entstanden zahlreiche Hypothesen zu
den psychologischen und physiologischen Hintergründen des Lachens, die
sich grob in drei Modelle einordnen lassen: Gemäß der
Überlegenheitstheorie tun wir es, wenn wir uns gegenüber einem
Mitmenschen überlegen fühlen. Die Inkongruenztheorie besagt, dass wir in
Gelächter ausbrechen, wenn etwas überraschend nicht unseren Erwartungen
entspricht. Und laut der Entladungstheorie löst es durch eine
Energiefreisetzung des Nervensystems einen Moment der Anspannung auf.
All diese Theorien bringen interessante Aspekte zu Tage, sie teilen
allerdings zwei Fehleinschätzungen, die jahrhundertelang weitergegeben
wurden und uns daran hindern, eines unserer häufigsten Sozialverhalten
zu verstehen.
Der erste Fehler liegt in der Verwechslung von Lachen und Humor: Obwohl es eine offensichtliche Verbindung zwischen beiden gibt, erforschen die oben erwähnten Modelle lediglich die kognitiven Ursprünge des Lachens, nicht aber das Phänomen selbst. Der US-amerikanische Psychologe Robert Provine (1943–2019), ein führender Experte auf dem Gebiet, hat oft beklagt, dass die Philosophen ihre Theorien gemütlich im Sessel sitzend entwickelten, ohne irgendwelche empirischen Daten zur Hand zu haben. Dabei ist es unerlässlich, den Pfad der Philosophie zu verlassen und die Frage als Verhaltensforscher anzugehen, um das Lachen so zu betrachten, wie es sich in der Natur tatsächlich offenbart. Das führt umgehend zu einer wertvollen Erkenntnis: Lachen ist in erster Linie eine kommunikative Lautäußerung, die in nicht humorvollen Kontexten auftritt.
Der zweite Irrtum besteht in der Annahme, nur die Spezies Mensch sei fähig zu lachen; eine Auffassung, die schon zu Aristoteles' Zeiten vorherrschte und nie wirklich hinterfragt wurde. Eine seltene Ausnahme bildete Charles Darwin (1809–1882), der Ende des 19. Jahrhunderts davon überzeugt war, »dass das Lachen als Zeichen der Freude oder des Vergnügens von unseren Vorfahren praktiziert wurde, lange bevor sie es verdienten, menschlich genannt zu werden«. Damit war Darwin seiner Zeit wieder einmal weit voraus, und es sollte etwa ein Jahrhundert vergehen, bis seine Auffassung ernst genommen wurde. Noch in den 1940er Jahren schrieb Helmut Plessner (1892–1985), der Begründer der deutschen philosophischen Anthropologie: »Der an den Anfang gestellte Satz, daß offenbar nur der Mensch über Lachen und Weinen verfügt, nicht aber das Tier, besagt keine Vermutung, die einmal durch Beobachtungen widerlegt werden kann, sondern eine Gewißheit.«
»Das Lachen wurde als Zeichen der Freude oder des Vergnügens von unseren Vorfahren praktiziert, lange bevor sie es verdienten, menschlich genannt zu werden« Charles Darwin
Bei allem Respekt
vor den Philosophen begann diese auf den Humor fokussierte und
anthropozentrische Betrachtung im 20. Jahrhundert zu bröckeln, als
Verhaltensforscher und Neurologen in einer neu entwickelten
»Neuroethologie des Lachens« deutlich machten, dass die bis heute
diskutierten Modelle lediglich die Spitze eines riesigen Eisbergs
darstellen. Vor allem der estnisch-amerikanische Psychologe
Jaak Panksepp (1943–2017) sowie sein oben erwähnte Kollege Robert
Provine wandten sich entschieden gegen die veralteten Ansichten. Als
Panksepp Ende der 1990er Jahre zum ersten Mal bei Ratten ein Verhalten beschrieb, das sowohl funktional als auch neuronal dem menschlichen Lachen entspricht,
ebnete er damit den Weg für vergleichende Untersuchungen bei Tieren.
Und Provine, der die Methoden der Verhaltensforschung (Ethologie) auf
die Erforschung des Lachens von Menschen und nicht menschlichen Primaten
übertrug, unterstrich die kommunikative und soziale Dimension desselben und grenzte es vom Humor ab. 
Da lachen ja die Nager | Ratten geben beim gemeinsamen Spiel
Ultraschalllaute von sich, die man als »Lachen« interpretieren könnte.
Dank
ihrer Arbeit können wir heute den drei oben beschriebenen
philosophischen Modellen eine neue Theorie zur Seite stellen, die
biologische Aspekte stärker berücksichtigt. Demnach dient das
menschliche Lachen primär dazu, soziale Bindungen zu schaffen und den
Zusammenhalt zwischen Individuen zu fördern. Evolutionär beruht es auf
tierischen Verhaltensweisen, die sich aus einer Kombination von
homologen (von einem gemeinsamen Vorfahren stammenden) mit
homoplastischen (ähnlichen, aber unabhängig voneinander entstandenen)
Merkmalen entwickelt haben.
Dieser neue Ansatz hat uns dazu
bewogen, den Stand der neuroethologischen Forschung zum Lachen aus
verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten. Das erste
Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein Sammelband, den wir 2022 in den »Philosophical Transactions of the Royal Society«
publizierten und zu dem mehr als 70 Fachleute aus unterschiedlichsten
Disziplinen beigetragen haben. Im Folgenden möchten wir die wichtigsten
Punkte dieses neuen Denkansatzes zusammenfassen.
Das Lachen der Ratten
Ende der 1990er Jahre beobachten Jaak Panksepp und Jeffrey Burgdorf bei Ratten eine Serie von kurz aufeinander folgenden Ultraschalllauten mit einer Frequenz von ungefähr 50 Kilohertz, welche die Tiere beim Spielen von sich geben und auch dann, wenn sie am Bauch gekitzelt werden. Ähnlich wie beim Menschen reagieren so vor allem Jungtiere, die sich in einer entspannten Situation befinden, während sie unter Stress (hervorgerufen etwa durch Katzengeruch oder störendes Lampenlicht) verstummen. Da sich dieses Fiepen deutlich von den bei Angst oder Stress erzeugten Lauten unterscheidet, schlossen die beiden Forscher, dass es evolutionär dem menschlichen Lachen entspricht und damit eine Grundlage für die ethologische und neurowissenschaftliche Erforschung positiver Gefühlsregungen bei Mensch und Tier liefert.
Falls Ratten tatsächlich lachen, dann sollten sich dafür zuständige Hirnregionen aufspüren lassen. Hier sind vor allem die subkortikalen, also unterhalb der Großhirnrinde liegenden Bereiche interessant, da sich diese im Lauf der Evolution – im Gegensatz zum Großhirn – nicht so stark verändert haben und deshalb bei Nagetieren den menschlichen eher ähneln. Und tatsächlich scheint ein bestimmtes subkortikales Areal in beiden Spezies eine Schlüsselrolle beim Lachen zu spielen: Der Nucleus accumbens (NAcc) gehört zum Belohnungssystem des Gehirns, das auf den Neurotransmitter Dopamin reagiert und bestimmte Verhaltensmuster durch Glücksgefühle verstärkt, was etwa bei Süchten eine Rolle spielt. Injiziert man den Dopaminagonisten Amphetamin in den NAcc von Ratten, geben die Nager prompt die typischen Fieplaute von sich.
Stimuliert man die gleiche Struktur bei menschlichen Patienten, bei denen ein solcher Eingriff wegen einer ohnehin nötigen Hirnoperation möglich ist, löst das Glücksgefühle bis hin zu regelrechten Lachsalven aus. Wie das Team um die Neurologin Elise Wattendorf von der schweizerischen Universität Freiburg 2019 mit bildgebenden Verfahren herausfand, regt sich der NAcc bereits dann, wenn den Versuchspersonen das Kitzeln nur angekündigt wird. Demnach ist diese Hirnregion schon bei einer entsprechenden Erwartung beteiligt, indem sie frühzeitig die zuständigen Hirnschaltkreise beeinflusst, noch bevor wir überhaupt berührt werden.
Dopaminausschüttung, Vergnügen sowie positive Verstärkung spielen also beim menschlichen wie beim tierischen Lachen eine entscheidende Rolle. Die Systeme regen sich vor allem beim Spiel und ganz allgemein, wenn Individuen in entspannter Situation interagieren, und festigen dabei soziale Beziehungen.Grooming auf Distanz
Auch der britische Anthropologe und Psychologe Robin Dunbar sieht im Lachen ein Werkzeug, das soziale Bindungen stabilisiert. Für ihn befindet es sich irgendwo zwischen typisch menschlichen, von Kultur und Sprache abhängigen Bindungsformen (wie Singen und Tanzen bei einem Konzert, ein gemeinsames Abendessen oder ein Kinobesuch) und eher urtümlichen Verhaltensweisen wie der Fellpflege unter Artgenossen. Bei Letzterer, auch Grooming genannt, regen sich bestimmte Mechanorezeptoren, die auf sanfte Berührungen der Haut ansprechen. Über langsam leitende Nervenbahnen gelangt die Information zur Inselrinde: einer Hirnregion, die emotionale Signale bewertet und unabhängig von dem auf taktile Reize spezialisierten somatosensorischen Kortex arbeitet. Daraufhin werden Glückshormone ausgeschüttet, was ein Gefühl der Freude, Ruhe und Entspannung hervorruft, Schmerzen lindert und die emotionale Verbundenheit zwischen den Beteiligten fördert.

Gemeinsamer Spaß | Dass auch Tiere lachen können, war lange unbekannt. Diese beiden Schimpansen scheinen sich zusammen zu amüsieren.
Die Berührung macht die Fellpflege zu einem hervorragenden Mittel der sozialen Bindung, doch sie lässt sich nur auf ein einzelnes Gegenüber anwenden und dauert eine gewisse Zeit, was die Zahl der beteiligten Sozialpartner zwangsläufig begrenzt. Dunbar zufolge gelten diese Einschränkungen nicht beim Lachen. Tatsächlich werden hier eher auditive und visuelle als taktile Kanäle genutzt, wodurch wir sehr schnell und mit vielen gleichzeitig ein »Grooming auf Distanz« durchführen können.
Bei Tieren erfüllen spielerische Geräusche und Laute wohl dieselbe Aufgabe. So spielen oft viele Individuen gemeinsam, manchmal gesellen sich Einzelne nach und nach hinzu und gelegentlich bilden sich regelrechte Gruppen. Dabei treten akustische und visuelle Signale kombiniert miteinander auf und verstärken sich gegenseitig, so dass alle Mitspieler erreicht werden. Ob das »Lachen« andere Individuen dazu animieren kann, sich ebenfalls in das Getümmel zu stürzen, bleibt noch zu erforschen.
Ein Team um den Neurologen Lauri Nummenmaa von der finnischen Universität Turku konnte 2017 die Hypothese des »Grooming auf Distanz« untermauern. Laut den Beobachtungen der Fachleute werden beim Lachen – genau wie beim zärtlichen Streicheln – in einer Reihe von Hirnarealen wie dem anterioren zingulären Kortex Opioide ausgeschüttet. Mit jemandem zu lachen, wirkt somit als positiver Verstärker, der dazu führt, dass man immer wieder die Nähe dieser Person sucht. Aber die Menschen sind nicht alle gleich. Die individuelle Dichte der hier beteiligten μ-Opioidrezeptoren geht Hand in Hand mit der jeweiligen Bereitschaft zu lachen. Anders ausgedrückt: Wer mehr davon besitzt, hat auch mehr zu lachen.
Gelächter im OP
Da einige Formen des
Lachens auf Krankheitsbilder hinweisen können, fokussierte sich die
Erforschung seiner neuronalen Grundlagen lange auf jene subkortikalen
Hirnregionen, die vermutlich krankhaftes Gelächter auslösen können: auf
den Hirnstamm, bei dem eine Verletzung pathologisches Lachen und Weinen
hervorrufen kann, sowie den Hypothalamus, der bei gelastischen
epileptischen Anfällen und bei der Kataplexie eine Rolle spielt. Dass
das Lachen demnach hauptsächlich den älteren, subkortikalen Strukturen
zugeordnet wurde, passte gut zu den philosophischen Modellen, die es als
eine banale Auswirkung von anspruchsvolleren, mit Humor verknüpften
kognitiven Vorgängen betrachteten. Die neue Theorie, die im Lachen einen
wesentlichen Bestandteil des sozialen Gehirns sieht, spricht jedoch für
eine ungleich komplexere kortikale Verankerung.
Die
neurobiologische Erforschung des Lachens steht vor zwei großen
Herausforderungen. Die erste ist technischer Natur: Die für Lachsalven
charakteristischen Körperbewegungen vertragen sich nicht mit den meisten
Techniken zur Hirnstrommessung, die von der Versuchsperson absolute
Regungslosigkeit erfordern. Das zweite und noch schwierigere Problem
besteht in der Unmöglichkeit, unter Laborbedingungen die sozialen
Umstände zu simulieren, die spontanes Gelächter hervorrufen können.
Patienten mit arzneimittelresistenter Epilepsie, bei denen daher eine Operation notwendig wurde, haben wir es zu verdanken, dass wir mehr über die Funktion diverser Hirnregionen lernen konnten. Denn bei ihnen ist es nach Zustimmung der Betroffenen möglich, zielgerichtet definierte Teile des Gehirns elektrisch zu stimulieren und die Effekte zu beobachten. In Zusammenarbeit mit dem Istituto di Neuroscienze des italienischen Consiglio Nazionale delle Ricerche in Parma sowie dem Centro Munari Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson in Mailand – einer weltweit führenden Institution für die chirurgische Behandlung von Epilepsie – sind wir damit endlich in der Lage, die neuronalen Geheimnisse des Lachens zu entschlüsseln.
Während der elektrischen Reizung kann
es passieren, dass der Patient alle anderen Bewegungen einstellt und in
schallendes Gelächter ausbricht. Diese seltsame Reaktion tritt jedoch
nur auf, wenn einer der folgenden vier Bereiche der Großhirnrinde stimuliert wird:
der anteriore zinguläre Kortex (ACC), der Temporalpol (TP), das
präsupplementär-motorische Areal (pre-SMA) oder das Operculum frontale
(FO). Sobald der Reiz endet, fällt es den Patienten schwer zu erklären,
was sie so zum Lachen brachte: Manche geben zu, dass sie den Grund nicht
kennen, während andere spontan Erklärungen erfinden.
Die
Stimulierung des pre-SMA und des FO erzeugt zuverlässig das motorische
Muster des Lachens (Gesichtsausdruck, Lautäußerung), nicht aber die
zugehörigen Emotionen. Werden dagegen der ACC oder der TP angeregt,
bewirkt das über die motorischen Aspekte hinaus ein echtes Glücksgefühl.
Demnach kontrollieren diese beiden letzteren Areale sowohl die
äußerlich wahrnehmbaren als auch die subjektiven, inneren Anzeichen des
emotionalen Lachens – ganz im Einklang mit der evolutionären These, nach
der das Lachen mit dem System der Belohnung und der positiven
Verstärkung eng verknüpft ist.
Wie Fachleute der Emory University 2019 beschrieben, kann bei einer Stimulation des ACC der Glückszustand sogar so intensiv sein, dass er negative Gefühle vorübergehend unterdrückt: Auf Aufforderung der Chirurgen schilderte ein Patient traurige Ereignisse wie den Tod des Familienhundes, wobei er weiterlachte. Obwohl ihm bewusst war, dass es sich um ein bedrückendes Erlebnis handelte, war er nicht in der Lage, es als solches wahrzunehmen – und amüsierte sich scheinbar weiter.
Zwei getrennte Netzwerke
Warum
gibt es im Gehirn so viele Areale, deren Stimulation ein Lachen auslöst?
Koordinieren sie gemeinsam eine einzelne Funktion oder sind sie für
unterschiedliche Aspekte zuständig? Mit Hilfe der
Diffusions-Tensor-Traktografie, eines bildgebenden Verfahrens, das die
Beziehungen zwischen Hirnarealen darstellt, haben wir 2021 die
Verbindungen zwischen diesen Bereichen untersucht. Wie sich dabei
offenbarte, bilden die Hirngebiete, deren elektrische Stimulation das
Lachen auslöst, tatsächlich zwei zum Teil getrennte neuronale Netzwerke (siehe »Netzwerke fürs Lachen«).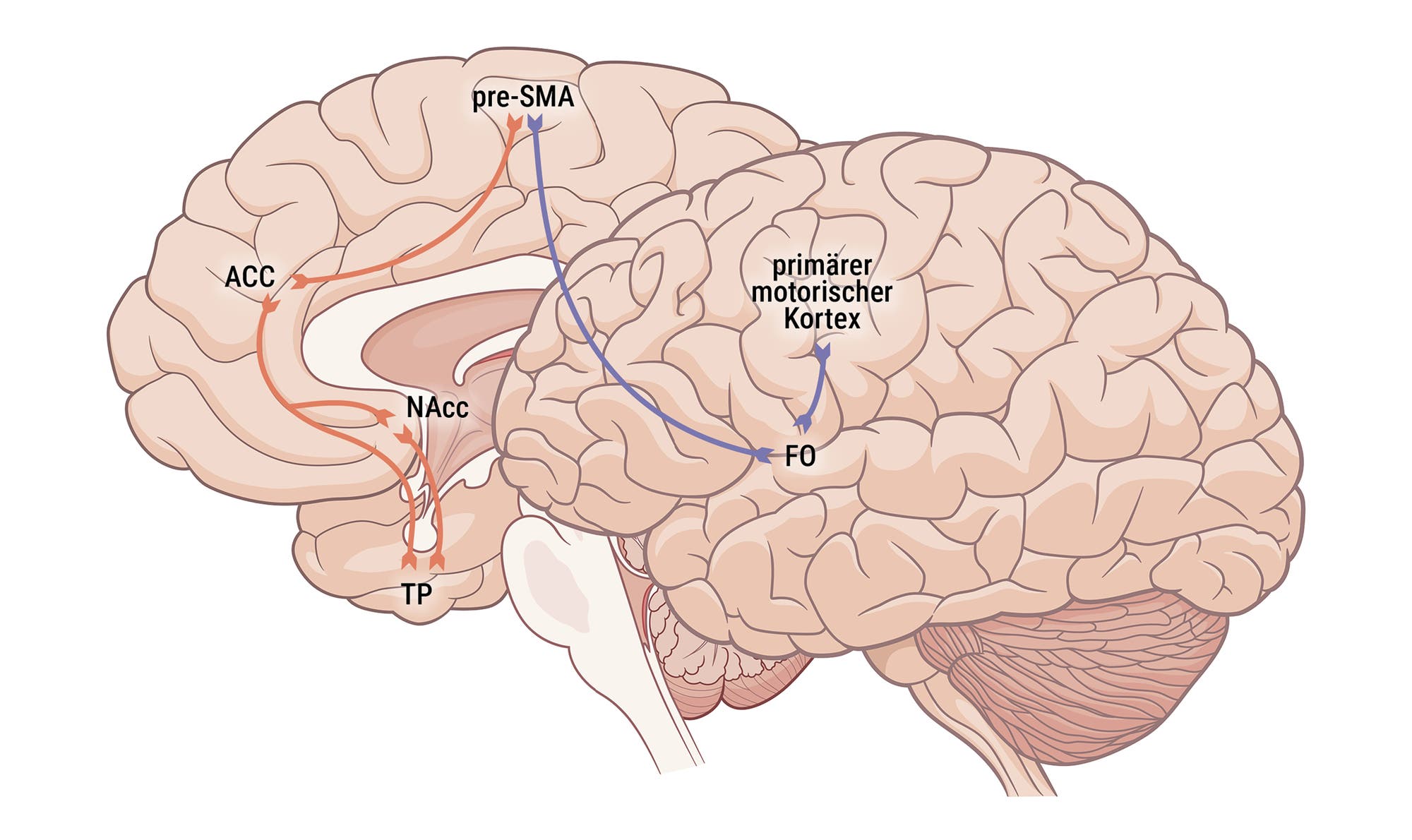
Netzwerke fürs Lachen | Ein Lachen kann aus der Aktivität zwei
verschiedener neuronaler Netzwerke entstehen: des emotionalen (rot)
sowie des der Willkürmotorik (blau). Anteriorer zingulärer Kortex (ACC),
Temporalpol (TP) und Nucleus accumbens (NAcc) steuern das emotionale
Lachen als Ausdruck der Freude, das durch die Ausschüttung von Opioiden
positive Gefühle hervorruft, das Belohnungssystem aktiviert und soziale
Bindungen fördert. Das präsupplementär-motorische Areal (pre-SMA) und
das Operculum frontale (FO), die zum System der Willkürmotorik gehören,
wirken an der bewussten Steuerung mit, wodurch wir das Lachen im Alltag
unterdrücken, verstärken oder vortäuschen können.
Das erste – bestehend aus dem ACC, dem TP und dem Nucleus accumbens – steuert das emotionale Lachen, indem es durch die Freisetzung von Opioiden positive Gefühle auslöst, das Belohnungssystem aktiviert und dadurch soziale Bindungen sowie das »Grooming auf Distanz« erleichtert. Es bildet, kurz gesagt, die neuronale Grundlage des Lachens, von dem bereits die Rede war.
Ein zweites Netzwerk mit dem pre-SMA und dem FO gehört zur Willkürmotorik und wirkt an der bewussten Steuerung mit. Im Alltag kommt es häufig vor, dass wir spontanes Lachen unterdrücken oder sogar verstärken, was nur durch bewusste motorische Kontrolle der emotionalen Bereiche möglich ist.
Normalerweise
arbeiten die Systeme eng zusammen; mitunter beeinträchtigen jedoch
einige neurologische Krankheiten eines der beiden. So können
Schädigungen des motorischen Systems Gesichtslähmungen auslösen, die es
dem Betroffenen unmöglich machen, ein Lachen willentlich vorzuspielen,
obwohl er spontan sehr wohl in authentisches Gelächter ausbrechen kann.
Umgekehrt bewirken manche degenerativen Erkrankungen, dass der Patient
die Fähigkeit des emotionalen Lachens einbüßt, es aber weiterhin
willentlich vortäuschen und gezielt einsetzen kann.
Eine
Sache ist allerdings seltsam: Im Unterschied zu den emotionalen
Zentren, die sämtliche beteiligte Gesichtsmuskeln steuern, kontrollieren
die motorischen Regionen vor allem die Muskeln der unteren
Gesichtshälfte und kaum die schwer bewusst beeinflussbaren oberen. Das
führte einige Psychologen wie Paul Ekman (siehe »Gehirn&Geist« April 2019, S. 36)
zu der Annahme, man könne ein echtes von einem vorgetäuschten Lachen
unterscheiden, indem man sich die Muskulatur der oberen Gesichtshälfte
ansieht, vor allem die Lachfältchen an den Augen.
Körperliche Gespräche
Läge der ursprüngliche evolutionäre Zweck des Lachens darin, soziale Bindungen herzustellen und spielerische Interaktionen zu erleichtern, wie dies bei nicht menschlichen Primaten und sogar bei Ratten der Fall ist, stellt sich die Frage: Wie können wir sicher sein, dass sich die Funktionen solcher Lautäußerungen nicht mit dem Entstehen der Sprache grundlegend verändert haben? Menschliches Lachen während eines Gesprächs könnte somit doch untrennbar mit Humor verknüpft sein.
Robert Provine, der das Lachen in realen sozialen Interaktionen über viele Jahre hinweg erforschte, konnte diesen Einwand entkräften. Wie seine Studien zeigten, besitzen nur 10 bis 20 Prozent der Sätze, die von einem Gelächter begleitet werden, einen humorvollen Inhalt, wobei der Sprecher mitunter sogar mehr schmunzelt als sein Zuhörer. Lachen folgt demnach komplexen sozialen Strukturen, in denen Geschlecht und Status der Gesprächspartner eine größere Rolle spielen als der Inhalt des Gesagten.
Nur 10 bis 20 Prozent der Sätze, die von einem Gelächter begleitet werden, besitzen einen humorvollen Inhalt
Diese Hypothese wird gestützt durch Beobachtung von spielenden Tieren, die dabei regelrechte körperliche Gespräche führen. Im Kampfspiel, in dem sich offensive Verhaltensformen (wie schubsen, beißen, den Partner anspringen) mit defensiven (ausweichen, fliehen) abwechseln, ist die Gefahr von Missverständnissen hoch. Wenn die Beteiligten nicht in der Lage sind, ihre Absichten zu kommunizieren (was bei jungen Individuen recht häufig der Fall ist), kann das Spiel ausarten und sich jemand verletzen. Aber Spielen ist wichtig! Es schult motorische und kognitive Fähigkeiten, fördert die soziale Kompetenz und schafft Bindungen. Die Evolution hat daher für effiziente Kommunikationssysteme gesorgt.

Fröhliches Spiel | Junge Hunde üben spielend wichtige Verhaltensweisen
ein. Subtile Kommunikationssignale verhindern, dass beim Getümmel etwas
Ernstes passiert.
Eine
Hypothese des Ethologen Nikolaas Tinbergen (1907–1988), der 1973 den
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für seine Studien über die
Signale in der Tierwelt erhielt, konnten wir 2016 bei Hunden bestätigen.
Kurz bevor er scheinbar aggressiv agiert, zeigt ein Hund oft eine Mimik, das so genannte Spielgesicht,
um seinem Gegenüber zu signalisieren, dass sein Verhalten nicht
wirklich gefährlich ist und »nur zum Spaß« geschieht. Spielerische
Begegnungen, die viel solches »Lachen« enthalten, dauern länger und
zeigen ein ausgewogeneres Verhältnis von offensiven zu defensiven
Verhaltensweisen, was das Spiel insgesamt harmonischer macht.
Hinzu
kommt der retroaktive Aspekt: Wenn etwas aus dem Ruder läuft und die
Begegnung zu eskalieren droht, kann das Spielgesicht beruhigend auf den
Gegner wirken und die Botschaft aussenden: »Entschuldigung, das war
nicht so gemeint.« Die Mechanismen ähneln mehr oder weniger den von
Emojis in modernen Textnachrichten.
Tatsächlich
argumentiert Provine, dass bei Mensch und Tier das Lachen nicht
zufällig platziert ist, sondern ähnlichen Regeln folgt wie die
Interpunktion in einem geschriebenen Text. So unterbricht es einen
gesprochenen Satz nicht, sondern erscheint an dessen Ende. Das lässt
sich kaum mit bloßen Lautbildungskriterien erklären, denn ein solcher Effekt tritt auch in der Gebärdensprache von Gehörlosen auf.
Beim Vergleich der Klangstruktur des Lachens beim Menschen und beim Menschenaffen stellte sich schließlich heraus, dass der Hauptunterschied in der – offenbar nur dem Menschen eigenen – Fähigkeit besteht, die verschiedenen Laute eines Lachens innerhalb eines einzigen Atemzugs zu segmentieren (da Menschenaffen nicht über diese Atemkontrolle verfügen, erstreckt sich bei ihnen der Lachlaut jeweils auf ein einzelnes Ein- oder Ausatmen). Laut Provines »Zweibeinertheorie der Sprachevolution» ermöglichte erst der aufrechte Gang die verbesserte motorische Atemkontrolle, die grundlegend für die Herausbildung der gesprochenen Sprache war und sich besonders in der spezifisch menschlichen Kontrolle der Lachlaute zeigt.
Lachen ist ansteckend
Ohne den Philosophen zu nahe treten zu wollen: Der häufigste Grund für ein spontanes Gelächter ist weder ein Gefühl von Überlegenheit noch eine Unstimmigkeit oder Erleichterung. Was uns am ehesten zum Lachen bringt, ist das Lachen eines anderen. Bis vor wenigen Jahren dachte man, das sei nur bei Menschen so. Doch 2008 entdeckte Marina Davila Ross von der britischen University of Portsmouth, dass Menschenaffen (die uns am nächsten verwandte Gruppe der Primaten) sich ebenfalls durch Lachen anstecken lassen. Wenn zwei Orang-Utans (Pongo pygmaeus) miteinander spielen, lachen sie sehr wahrscheinlich auch gemeinsam. 2013 konnten wir das gleichfalls beim Dschelada (Theropithecus gelada) nachweisen, einer im Hochland von Äthiopien lebenden Pavianart. Ansteckendes Lachen scheint also viel ältere Wurzeln zu haben als früher angenommen.
Was uns am ehesten zum Lachen bringt, ist das Lachen eines anderen
Wenn das Lachen eines Spielenden den anderen häufig ansteckt, so festigt sich laut weiteren Studien die Bindung zwischen den beiden, so dass sie noch mehr miteinander interagieren. Das wirkt sich wiederum auf andere Bereiche wie Fellpflege, gegenseitige Unterstützung in Konflikten oder in Kooperationen aus – ein überlebenswichtiges Verhalten in komplexen Gemeinschaften, in denen es auf die Fähigkeit ankommt, Freundschaften zu knüpfen.
Zwar helfen uns Tiere, die evolutionäre Bedeutung des
ansteckenden Lachens zu ergründen; um die neuronalen Schaltkreise zu
verstehen, die diesem faszinierenden Phänomen zu Grunde liegen, müssen
wir allerdings den Menschen betrachten. Laut Provine deutet die
Ansteckungsfähigkeit von Lachen darauf hin, dass unsere Spezies über
einen akustischen »Merkmalsdetektor« verfügt: einen Nervenschaltkreis,
der ausschließlich auf diese Lautäußerung anspricht und das motorische
Muster des Lachens beim Zuhörer in Gang setzt. Wie wir aus
bildgebenden Verfahren wissen, werden beim Wahrnehmen eines Gelächters
auditorische und visuelle Bereiche höherer Ordnung aktiviert, die darauf
spezialisiert sind, dynamische Gesichtsausdrücke zu erkennen. Provine
aber meinte etwas anderes: Er geht davon aus, dass es im Gehirn einen
Bereich gibt, in dem sich »mein« und »dein« Lachen überlagern – ein
Zentrum, das für die motorische Kontrolle meines Verhaltens zuständig
ist, das jedoch ebenfalls aktiviert wird, wenn ich das Gelächter eines
Mitmenschen wahrnehme. Doch wie soll man das untersuchen?
Nachdem
wir die Hirnzentren entdeckt hatten, deren Stimulation das Lachen
hervorruft, gingen wir einen Schritt weiter: Wir präsentierten den oben
genannten Epilepsiepatienten Filmsequenzen, in denen Schauspieler
lachten, weinten oder einen neutralen Gesichtsausdruck zeigten. Im
Gegensatz zur Studie zuvor nutzten wir nun die ins Gehirn eingeführten
Elektroden nicht, um Hirnbereiche zu stimulieren, sondern um
Nervensignale aufzuzeichnen. Wie wir dabei beobachteten, regt sich der ACC sogar dann, wenn man lediglich jemanden lachen sieht.
Wenn ich also das Gelächter eines anderen wahrnehme, wird diese
Information nicht nur im auditorischen und visuellen Hirnbereich
analysiert, sondern auch schnell an den ACC weitergeleitet. Der wiederum
kontrolliert mein emotionales Lachen, fördert die Ausschüttung von
Opioiden sowie das »Grooming auf Distanz« und sorgt dafür, dass ich mich
von der Heiterkeit anstecken lasse. Lachen ist deshalb der beste
soziale Kitt!
Lachen ist keineswegs typisch für uns Menschen und hat nicht unbedingt etwas mit Humor zu tun
Damit können wir nun auf die Fragen zu Beginn des Artikels zurückkommen und einige Schlüsse ziehen. Entgegen der zwei Jahrtausende lang tradierten Auffassung lässt sich heute sagen, dass Lachen keineswegs typisch für uns Menschen ist und nicht unbedingt etwas mit Humor zu tun hat. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes Verhalten, das wichtige uralte Funktionen erfüllt, die wir mit vielen anderen Tierarten teilen – soziale Bindungen zu knüpfen, spielerische und partnerschaftliche Interaktion zu fördern, Spannungen abzubauen. Das kann uns zur Bescheidenheit mahnen: Selbst wenn wir zum Mond fliegen, Gedichte schreiben, Theoreme beweisen oder Brücken bauen, sprechen wir immer noch die Sprache unserer Vorfahren.
Übersetzung aus

Ja, das Lachen ist ein Geflecht aus vielen ganz verschiedenen Fäden. Humor ist eine Spezifikation, die Sinn und Widersinn zur Voraussetzung hat. Die mussten zum Lachen hinzukommen, damit es sich zu Humor kultivieren konnte. Er ist eine Sublimierung einer organischen Funktion aus frühen Entwicklungsstadien der (Vor-)Menschen.
Ach, es hieß ja: nicht unbedingt mit Humor zu tun! Neun von zehn Gelächtern erfolgen ohne witzige Sprachbegleitung. Aber Witze, die verstanden wurden - behaupte ich - werden zu hundert Prozent von Gelächter begleitet. Man lacht besonders gern beim Spielen. Man spielt - behaupte ich - besonders gern, damit man was zu lachen hat. Wie Ratten und Hundewelpen!
Wir Menschn sind nicht die einzigen, die spielen. Aber wir sind die einzigen, die bis an ihr Lebensende spielen können und wollen. Und dafür brauchen wir unsern Hu-mor - behaupte ich.
JE


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen