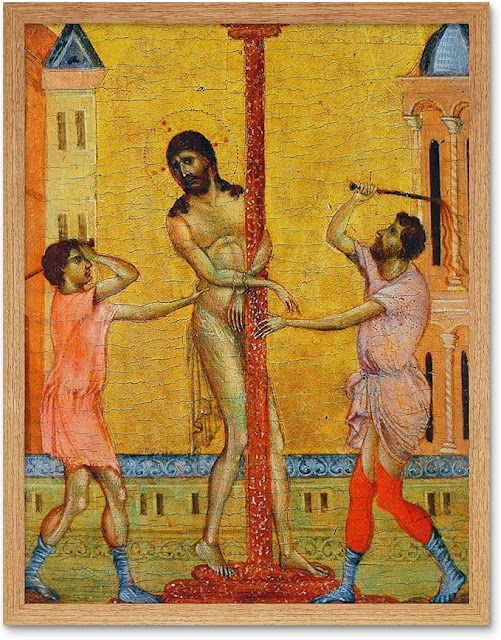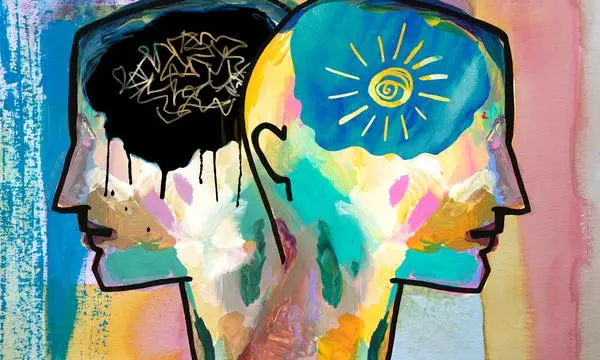zu Jochen Ebmeiers Realien
zu Jochen Ebmeiers Realien
Die Hirnforschung hat in den letzten Jahrzehnten spektakuläre Fortschritte ge-macht, die nach und nach in die Allgemeinbildung eingehen. Das hat aber auch eine Kehrseite: indem es nämlich unsere Selbstwahrnehmung unmerklich in eine Schief-lage bringt. War in den achtziger Jahren viel Getös um ein sogenannte Bauchgefühl, hinter dem alle "kopfigen" Gehirnfunktionen als Kleinkrämerei erschienen, ist seit-her fast in Vergessenheit geraten, dass der Mensch außer aus einem Gehirn auch in einem Leib besteht.
Das ist auch in pedantischster theoretischer Wissenschaft von Belang, weil es den ausschlaggebenden und unhintergehbaren Unterschied zur Künstlichen Intelligenz ausmacht - denn die hat keinen Leib als Sensorium und Informanten in der Welt wie die natürliche Intelligenz, und kein materielles Instrumentarium, mit dem sie selbstgesetzte Zwecke verwirk lichen kann; und darum wird sie auch kein Denkor-gan entwicklen, das Zwecke erfinden kann - und wird, streng genommen, selber gar nichts entwickeln.
Darum hier ein knapper Umriss dessen, was der
"denkenden" Maschine ewig fehlen wird:
Der
Nervus vagus, auch bekannt als der zehnte Hirnnerv (N. X), ist ein
wichtiger Nerv, der sich vom Gehirn bis in den Bauchraum erstreckt und
viele innere Organe beeinflusst. Er
ist der Hauptnerv des Parasympathikus und spielt eine entscheiden-de
Rolle bei der Regulation von Herzfrequenz, Verdauung, Atmung und mehr.
Hauptfunktionen:
Regulation des parasympathischen Nervensystems:
Der Vagusnerv ist für Ruhe, Erholung und Verdauung zuständig.
Übertragung von Informationen:
Er übermittelt sensorische Informationen vom Gehörgang, Rachen und Bauchraum an das Gehirn.
Motorische Funktionen:
Verbindung zwischen Gehirn und Körper:
Der Vagusnerv ist ein wichtiger Kommunikationsweg zwischen Gehirn und Körper.
Stress und Emotionen:
Die Aktivität des Vagusnervs ist eng mit Stress und Emotionen verbunden.
Anlage verschiedener Erkrankungen:
Eine
Dysfunktion des Vagusnervs kann mit verschiedenen Erkrankungen in
Verbindung gebracht werden, wie Angst, Depressionen, Stress und
chronische Krankheiten.
Beeinflussung innerer Organe:
Er beeinflusst Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, Verdauung und vieles mehr.
Zusammenfassend: Der Vagusnerv ist ein vielseitiger und wichtiger Nerv, der für viele Funktionen des Körpers von Bedeutung ist. Er
spielt eine zentrale Rolle in der Regulation des parasympathischen
Nervensystems, der Kommunikation zwischen Gehirn und Körper sowie bei
der Stressregulation und hat eine vielfältige Auswirkung auf den
menschlichen Körper.
Das
"Sonnengeflecht" (Plexus solaris) ist ein Nervengeflecht im
menschlichen Körper, das sich zwischen dem Brustbein und dem Bauchnabel
befindet. Es
ist Teil des vegetativen Nervensystems und dient der Weiterleitung von
Informationen zwischen dem Gehirn und den Eingeweiden sowie den
Blutgefäßen im Bauchraum. Das Sonnengeflecht reguliert die Funktion der Bauchorgane und der Blutgefäße in der Bauchhöhle.
Informationen weiterleiten:
Das Sonnengeflecht leitet Informationen vom Gehirn zu den Bauchorganen und umgekehrt weiter.
Funktion der Bauchorgane regulieren:
Es hilft bei der Steuerung der Funktion der Bauchorgane, wie z. B. Verdauung, Atmung und Blutdruckregulation.
Blutgefäße im Bauchraum regulieren:
Es beeinflusst die Durchblutung der Bauchorgane und die Regulation des Blutdrucks.
Es liegt in der Tiefe des Oberbauchs, zwischen Magen und Hauptschlagader (Aorta).
Eng benachbart: Es wird von zwei Nervengeflechten gebildet, dem Plexus mesentericus superior und dem Plexus coeliacus.
Einfluss des Vagusnervs:
Auch der Vagusnerv (Nervus vagus) spielt eine Rolle, indem er parasympathische Fasern zum Sonnengeflecht leitet.
Schmerzfortleitung:
Das Sonnengeflecht ist auch an der Fortleitung von Schmerzen aus dem Bauchraum ins Gehirn beteiligt.
Es
ist wichtig zu beachten, dass die bewusste Steuerung des
Sonnengeflechts nicht möglich ist, da es zum vegetativen Nervensystem
gehört.
Quelle: Wikipedia.