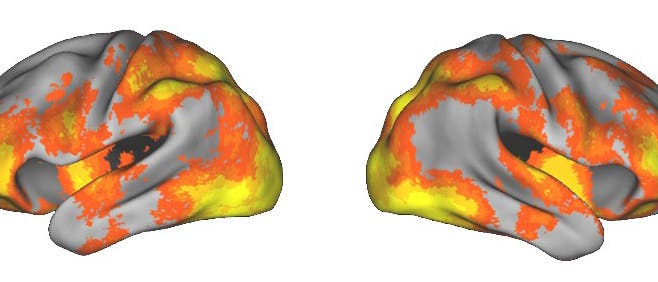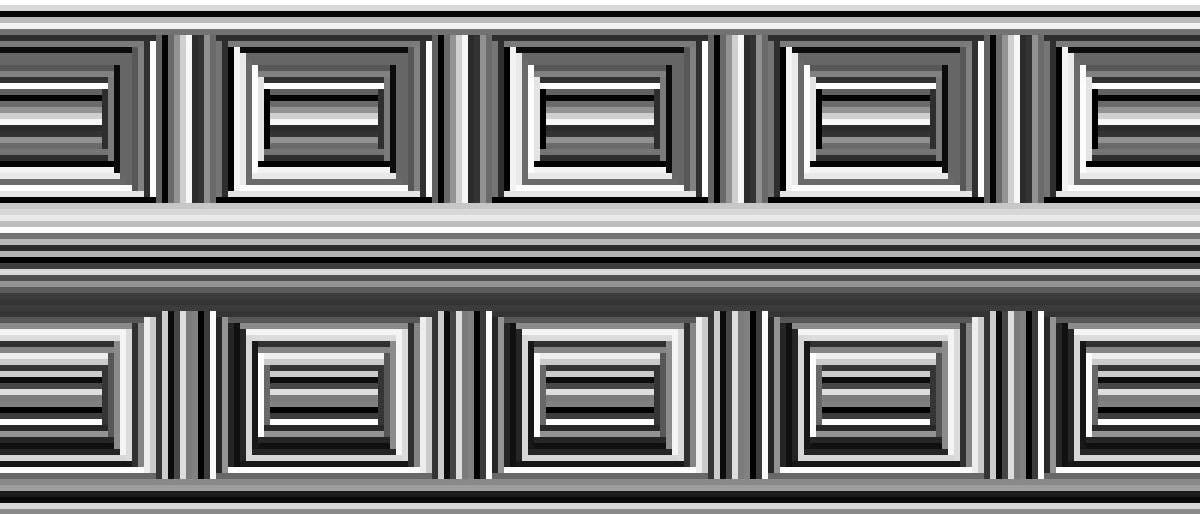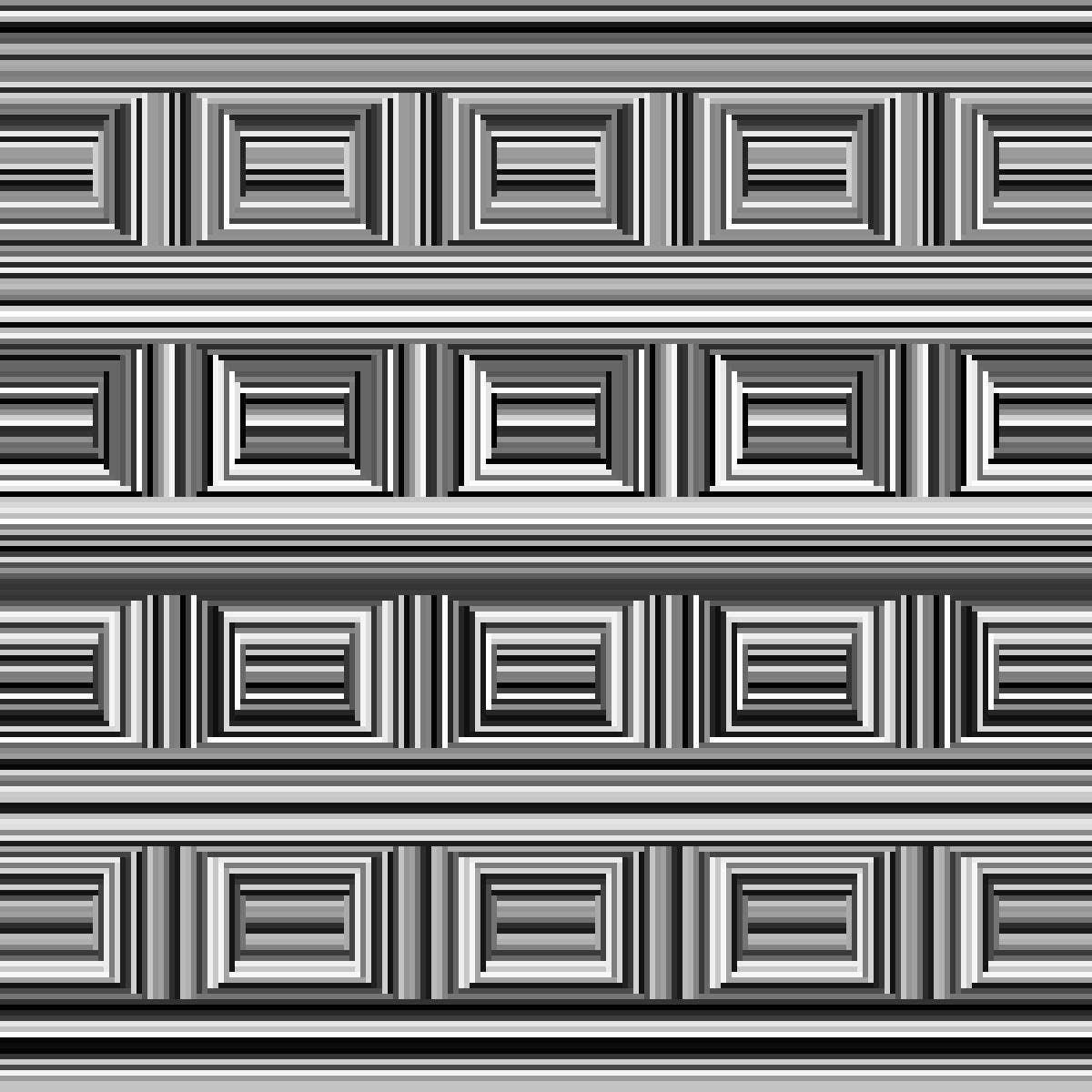aus welt.de, 26. 8. 2025 Bogenschützen entschieden die Schlacht von Crécy zu öffentliche Angelegenheiten
Als Eduard III. von England 1346 bei Crecy auf die Franzosen traf, brach er mit dem ritterlichen Ehrenkodex. Seine Kavallerie kämpfte zu Fuß und seine Schützen mit einer fürchterlichen Waffe: Ihre Langbögen durchschlugen jede Rüstung.
Für seine Zeitgenossen kam König Johann von Böhmen (1296–1346) dem Ideal des edlen Ritters sehr nahe. Der Sohn des Kaisers Heinrich VII. glänzte in Turnieren, machte sich als Kreuzfahrer wie Feldherr einen Namen und erfüllte in gefährlichsten Situationen seinen Eid, selbst nachdem er auf beiden Augen erblindet war. Weil Johann Frankreichs König Philipp VI. (1293–1350) die Gefolgschaft versprochen hatte, ließ er sich am 26. August 1346 bei Crécy von seiner Leibgarde in die Schlacht gegen Eduard III. von England führen. „Sie wagten sich so weit vor, dass sie dort alle erschlagen wurden, und am nächsten Tag fand man sie ..., und alle ihre Pferde waren aneinandergebunden“, berichtet der Chronist Jean Froissart.
Die Schlacht von Crécy ist die erste große Schlacht des sogenannten Hundertjährigen Krieges (1337–1453). Darin ging es nach dem Aussterben der französischen Kapetinger um die Frage, ob den Nebenlinien der Valois in Frankreich oder der Anjou-Plantagenêt in England die Nachfolge zukam. Wiederholt musste Frankreich vernichtende Niederlagen – nach Crécy bei Maupertuis (Poitiers) 1356 und Azincourt (1415) – und sogar die Eroberung von Paris hinnehmen. Aber am Ende ging die französische Krone gestärkt aus dem Konflikt hervor, der England fast alle Besitzungen auf dem Festland kostete.Auch militärgeschichtlich markierte der Hundertjährige Krieg einen tief greifenden Wandel. Denn ihre großen Siege gegen zahlenmäßig überlegene Heere verdankten die Engländer dem Einsatz einer Waffengattung, die bis dahin eine untergeordnete, ja verachtete Rolle auf den Schlachtfeldern des Mittelalters gespielt hatte: Leicht bewaffnete Fußsoldaten verdrängten den adligen Panzerreiter. Distanzwaffen wie Bogen, Armbrust und Kanone sollte die Zukunft gehören.
Nachdem Philipps Truppen 1337 Eduards Besitzungen in Aquitanien besetzt hatten, antwortete dieser mit der Annahme des französischen Königstitels. Im Juli 1346 landete der Engländer nach umfangreichen Vorbereitungen mit 15.000 Mann in der Normandie. Um sich eine Basis für weitere Kämpfe in Nordfrankreich zu schaffen, zog Eduard zur Seine, die er nördlich von Paris überquerte und sich von dort Richtung Norden, zur Somme wandte. Mit etwa 25.000 Mann nahm Philipp die Verfolgung auf, darunter 6000 genuesischen Armbrustschützen.
Als Eduard erkannte, dass er Philipp nicht abschütteln konnte, nahm er am 26. August am Wald von Crécy-en-Ponthieu, 17 Kilometer nördlich von Abbeville, eine Defensivposition ein. Das Heer wurde auf einem Hügel quer zur Straße aufgestellt. Dabei brach er gleich doppelt mit überkommenen ritterlichen Traditionen. Zum einen konzentrierte er seine 6000 Bogenschützen vor dem Zentrum und an den Flanken. Zum anderen befahl er seiner schweren Kavallerie, vom Pferd zu steigen und die leicht bewaffneten Schützen zu Fuß zu sichern, damit diese nicht von einer feindlichen Attacke niedergeritten werden konnten.
Mit was für einer Waffe der Engländer die Entscheidung suchen wollte, hat der britische Feldmarschall und Militärhistoriker Bernhard Montgomery beschrieben: „Die englischen langen Bogen waren 193 Zentimeter hoch. Die Zugkraft beim Spannen betrug etwa einen Zentner. Gewöhnlich waren sie aus Eiben- oder Ulmenholz. In der Mitte waren sie etwa vier Zentimeter breit, rund drei Zentimeter dick, außen flach und innen rund. Sie liefen spitz zu und endeten mit für die Sehne durchbohrten Hornspitzen. Die Sehne bestand aus Hanf- und Leinenfasern. Der Pfeil war etwa 94 Zentimeter lang, hatte eine kleine, nicht besonders scharfe, rautenförmige Spitze und trug am Ende drei halbe Gänsefedern. Die Sehne wurde in einem Zug bis zum Unterkieferwinkel zurückgezogen, der Schütze zielte und ließ den Pfeil fliegen. Bis auf etwa 240 Meter ließ sich ein gezielter Schuss abgeben, die äußerste Reichweite betrug etwa 350 Meter.“

Experimente mit Nachbauten haben die Überlieferung bestätigt, dass ein Schütze bis zu zehn Schuss pro Minute abgeben konnte. Denn sie waren darin geübt. In der umfangreichen Literatur, die sich mit dem englischen Langbogen beschäftigt, finden sich zahlreiche Beschreibungen von Experimenten. Demnach konnte ein Pfeil noch auf 200 Metern Entfernung ein 2,5-Zentimeter starkes Brett durchschlagen.
Eduard hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel: Disziplin. Seine Bogner waren keine fremdländischen Söldner, sondern freie Untertanen, die zum regelmäßigen Schusstraining verpflichtet und dafür vom Besuch der Sonntagsmesse freigestellt waren. Sie gehörten keinem Aufgebot eines Adligen an, sondern ein Vertrag, in dem Pflichten und Leistungen festgelegt waren, verband sie mit dem König. Bemerkenswert ist, dass Eduards Autorität stark genug war, um seine Ritter zur Aufgabe ihrer Pferde zu bewegen.

Das war Philipp nicht vergönnt. Als die Franzosen am Nachmittag das englische Heer erreichten, wurden zunächst die Genuesen vorgeschickt. Ihre Armbrüste erlaubten nur eine Schussfolge von zwei Schuss pro Minute, die durch den einsetzenden Regen noch deutlich reduziert wurde. Als ihr Angriff im Pfeilhagel der englischen Bogenschützen liegen blieb, kannten die französischen Ritter kein Halten. Ohne auf taktische Kommandos oder Notwendigkeiten zu achten, gingen die Ritter ungeordnet in die Offensive, wobei sie ihrer Verachtung für die eigenen Söldner freien Lauf ließen, indem sie sie einfach niederritten.
In drei Wellen setzten die französischen Ritter zur Attacke an und wurden durch die Pfeile der Langbogen zurückgeworfen. Sie flogen „so dicht an dicht, dass es wie Schnee war“, schreibt Jean Froissart: „Die scharfen Pfeile durchbohrten die Soldaten und ihre Pferde.“ Da auch die englischen Ritter zu Fuß ihre Position hielten und damit Einbrüche in die Linie verhinderten, türmten sich vor ihnen gestürzte Franzosen. „Unter den Engländern gab es Schurken, die mit großen Messern zu Fuß unterwegs waren, und sie töteten und ermordeten viele, die am Boden lagen, sowohl Grafen, Barone, Ritter als auch Knappen“, klagte der Chronist.
Rund 1500 Ritter fielen, neben dem König von Böhmen auch zahlreiche Hochadlige. Das Gros der Verluste, 8000 Mann oder mehr, entfiel jedoch auf namenlose Fußsoldaten, während die Engländer nur einige hundert Mann verloren haben sollen. Dennoch erwies sich Crécy nicht als die erhoffte Entscheidungsschlacht. Zwar konnte Eduard in der Folge das strategisch wichtige Calais erobern. Aber seine Kräfte reichten nicht aus, um Nordfrankreich zu einer sicheren Position auszubauen.