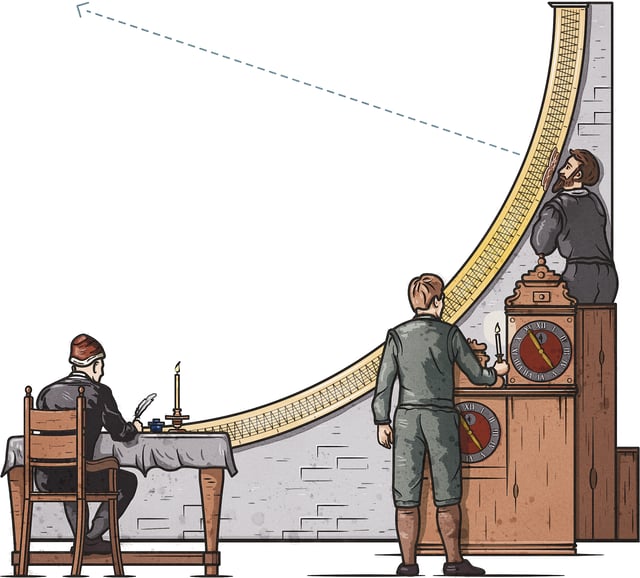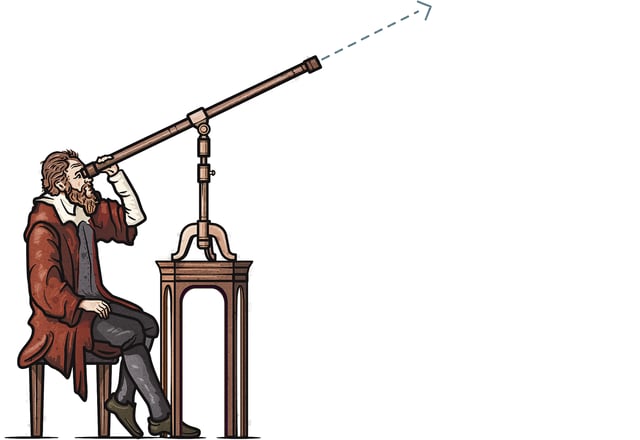Kopernikusstandbild in Thorn (Toruń)
Kopernikusstandbild in Thorn (Toruń)
aus nzz.ch, 26. 11. 2025 zu Jochen Ebmeiers Realien
Nikolaus
Kopernikus rückte die Sonne ins Zentrum des Kosmos und degradierte die
Erde zu einem gewöhnlichen Planeten. Die meisten Zeitgenossen hielten
seine Idee aber bloss für ein Rechenmodell. Der vierte Teil unserer
Serie zu den grössten Erkenntnissen der Wissenschaft.
von Martin Amrein (Text) und Daniel Röttele (Infografik)
Der
junge Mathematiker Georg Joachim Rheticus war entsetzt, als er das
frisch gedruckte Buch aufschlug: «De revolutionibus orbium coelestium»,
verfasst von seinem Lehrer Nikolaus Kopernikus. Er hatte Kopernikus bei
der Fertigstellung geholfen und ihn gedrängt, das Werk endlich zu
veröffentlichen. Rheticus war es auch, der das kostbare Manuskript zur
Druckerei in Nürnberg gebracht hatte. Nun, an diesem Frühlingstag im
Jahr 1543, sass er in Leipzig, wo er eben eine Professur angetreten
hatte, und entdeckte, dass jemand ohne sein Wissen ein anonymes Vorwort
in das Buch gesetzt hatte. Und was für eines.
Dieses
Werk beschreibe zwar, dass die Erde sich bewege und die Sonne im
Zentrum des Universums ruhe, stand da. Doch diese Hypothese müsse nicht
wahr sein, sie diene nur als Hilfe, um die Bahnen der Himmelskörper zu
berechnen. Rheticus versuchte noch, eine Neuauflage in die Wege zu
leiten, scheiterte jedoch. Dafür erreichte der unbekannte Autor des
Vorworts sein Ziel: Viele Leser glaubten, die einleitenden Zeilen
stammten von Kopernikus, und betrachteten das Buch als reine
Rechenhilfe, nicht als Manifest eines neuen Weltbilds.
Dieses
Weltbild, das heliozentrische, mit einem Kosmos, in dessen Mitte die
Sonne stand, hatte Kopernikus im Stillen entwickelt. Im Alltag war er
ein Mann der Kirche. Er wirkte als Domherr in Frauenburg, einer kleinen
Stadt im polnischen Reich. Die Stelle verdankte er seinem
einflussreichen Onkel, dem Bischof der Region. Zuvor hatte er
Mathematik, Astronomie, Medizin und Recht studiert. Als Domherr
verwaltete er die Ländereien und die Finanzen des Bistums.
Kopernikus
musste zölibatär leben. Dafür blieb ihm die Freiheit, sich neben den
kirchlichen Pflichten seiner wahren Leidenschaft zu widmen: der
Astronomie. Nacht für Nacht beobachtete er die Planeten und notierte
ihre Positionen. Dabei wuchsen seine Zweifel am Bild des Kosmos mit der
Erde im Zentrum, das für seine Zeitgenossen im 16. Jahrhundert eine
Selbstverständlichkeit war.
Vor
allem ein Phänomen machte Kopernikus zu schaffen: Beobachtet man die
Planeten von der Erde aus, ziehen sie immer wieder seltsame Schleifen
über den Himmel.
Die Schleifen der Planeten
Schauen
wir von der Erde aus über längere Zeit zum Mars, so scheint er sich in
eine Richtung zu bewegen, einen Bogen zu schlagen, während einiger
Wochen zurückzuwandern, um danach wieder auf seiner gewohnten Bahn
fortzufahren.
Im
heutigen Weltbild, in dem die Erde um die Sonne kreist, lässt sich
dieses Phänomen leicht deuten. Das zeigt der Blick aus dem Weltraum auf
die Erde und den Mars. Ungefähr alle zwei Jahre überholt die Erde auf ihrer schnelleren Innenbahn den Mars. Dabei
scheint der Mars für den Beobachter von der Erde aus für einige Wochen
rückwärtszulaufen: Die Schleife ist eine reine Perspektivtäuschung.
Im geozentrischen Modell mit der Erde im Mittelpunkt brauchte es für dieses Rätsel dagegen eine eigene Erklärung.
Diese
hatte der griechische Gelehrte Ptolemäus bereits im 2. Jahrhundert
gefunden, als er das antike Wissen über den Himmel zusammenführte und in
ein kohärentes System brachte. Dieses System beruhte auf dem
geozentrischen Weltbild des Aristoteles: Die Erde galt als unbeweglicher
Mittelpunkt des Universums, während Sonne, Mond und Planeten auf
unsichtbaren Bahnen um sie herum kreisten.
Um
die Schleifen der Planeten im geozentrischen Weltbild zu erklären, nahm
Ptolemäus an, sie bewegten sich auf sogenannten Epizykeln. Das sind
kleinere Kreise, deren Mittelpunkte die eigentliche Kreisbahn um die
Erde vollführen. Durch die geschickte Wahl der Grösse dieser
Trägerkreise und der Epizykeln liessen sich die beobachteten
Planetenbahnen erstaunlich genau beschreiben.
Das geozentrische Weltbild nach Ptolemäus.
Schon
griechische Denker fragten sich, ob die Erde um die Sonne kreisen
könnte. Doch gegen die Lehrmeinung des Aristoteles konnte sich die Idee
nie durchsetzen. Hingegen war die Vorstellung von der flachen Erde zur
Zeit von Ptolemäus längst überwunden. Sie ist zwar in vielen alten
Schöpfungsmythen zu finden, doch bereits die Griechen gingen von einer
kugelförmigen Erde aus. Dass noch die Christen des Mittelalters die Erde
für eine Scheibe hielten, ist eine Legende.
Das
ptolemäische Weltbild mit der Sonne, die sich um die Erde dreht, blieb
bis ins 16. Jahrhundert fest verankert. Die Kirche betrachtete das
Modell als unverrückbare theologische Wahrheit, stellte es doch den
Menschen als Krone der Schöpfung ins Zentrum von allem. Zudem stimmte es
mit der Bibel überein: Josua bat Gott im Alten Testament, die Sonne
stillstehen zu lassen, nicht etwa die Erde. Und schliesslich schien auch
die alltägliche Erfahrung dafür zu sprechen. Wer konnte sich ernsthaft
vorstellen, dass die schwere Erde durchs All raste, ohne dass man das
Geringste davon spürte?
Selbst
den Astronomen bot Ptolemäus ein mächtiges Instrument: Sein Modell
ermöglichte es, die Positionen der Himmelskörper in der Vergangenheit
und in der Zukunft zu berechnen. Dafür akzeptierten sie, dass die
Planeten wie betrunken durch den Himmel torkelten.
Kopernikus
aber missfiel die komplizierte Konstruktion der
ineinandergeschachtelten Kreise: Sie widersprach der Vernunft, fand er.
Auf der Suche nach einem eleganteren System wagte er einen Schritt,
dessen Dramatik aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar ist. Er
rückte die Sonne ins Zentrum des Kosmos und degradierte die Erde zu
einem gewöhnlichen Planeten.
Das heliozentrische Weltbild nach Kopernikus.
Kopernikus
nutzte dieselben Positionsdaten und Umlaufzeiten, die schon Ptolemäus
festgehalten hatte, erklärte sie aber mit einer ganz anderen Geometrie.
Damit fand er endlich eine plausible Erklärung für die Schleifen, die
die Planeten scheinbar vollziehen. Aber auch für andere Rätsel – etwa,
warum Merkur und Venus von der Erde aus stets in Sonnennähe zu sehen
sind. Im heliozentrischen Modell ist die Lösung ganz einfach: Ihre
Umlaufbahnen liegen innerhalb der Erdbahn, wodurch sie enger um die
Sonne kreisen.
In
einem kurzen handschriftlichen Traktat, das er «Commentariolus» nannte,
legte er 1514 die Prinzipien seines Systems dar. Er stellte sieben
Thesen auf, darunter die zentrale: «Alle Bahnen umgeben die Sonne, als
stünde sie in aller Mitte, daher liegt der Mittelpunkt der Welt in
Sonnennähe.» Kopernikus gab das Manuskript an einige wenige Gelehrte
weiter, denen er vertraute. Wie eine geheime Botschaft wanderte es von
Hand zu Hand und weckte Neugier auf das neue Weltbild, das im
abgelegenen Frauenburg entstanden war.
In
den nächsten Jahren hielt sich Kopernikus bedeckt. Er arbeitete an
einem Buch, das seine Theorie systematisch darstellte, veröffentlichte
es aber vor allem aus Furcht vor dem Spott anderer Gelehrter nicht.
Erst ein unerwarteter Besuch verlieh ihm den nötigen Mut. Im Frühling
1539 stand Georg Joachim Rheticus vor seiner Tür. Der 25-Jährige hatte
die wochenlange Reise von Sachsen nach Frauenburg angetreten, weil er
die Gerüchte von Kopernikus’ neuer Kosmologie gehört hatte. Rheticus
wollte mehr darüber erfahren.
So
bekam Kopernikus, im Alter von 66 Jahren, erstmals einen Schüler.
Geduldig erläuterte er ihm die Vorzüge des heliozentrischen Systems.
Rheticus war begeistert, so sehr, dass er die nächsten zwei Jahre in
Frauenburg blieb. Umgekehrt hatte Rheticus seinem Lehrmeister etwas zu
bieten: Er hatte Beobachtungsdaten zu Merkur mitgebracht, die Kopernikus
noch fehlten. Zudem unterstützte er ihn bei weiteren Messungen, gleich
zwei partielle Sonnenfinsternisse verfolgten die beiden gemeinsam.
Vielleicht noch wichtiger: Der junge Mathematiker überprüfte die
Berechnungen und Tabellen, die Kopernikus für sein Buch erstellt hatte,
und half, das Werk neu zu gliedern.
Am
entscheidendsten aber war, dass er Kopernikus davon überzeugte, das
Buch zu veröffentlichen. Den Drucker organisierte Rheticus ebenfalls.
Allerdings
zog sich der Druck in Nürnberg hin. «De revolutionibus» war ein
monumentales Werk voll mit Tabellen, Zahlenreihen und Diagrammen, die
aufwendig als Holzschnitte eingefügt werden mussten. Briefe zwischen
Frauenburg und Nürnberg brauchten Wochen, und Kopernikus selbst zögerte
mit Korrekturen. Es wurde Mai 1543, bis er das Buch in seinen Händen
hielt. Viel davon nahm er aber nicht mehr wahr. Einige Monate zuvor
hatte ihm ein Schlaganfall seine mentalen Kräfte geraubt. Nun lag er
bereits im Sterben.
Unter
Astronomen stiess das Buch zwar auf Interesse, weil es präzise
Kalkulationen und nützliche Tabellen enthielt. Doch die meisten glaubten
dem Vorwort und betrachteten es als blosses Rechenmodell. Auch die
Kirche zeigte sich ungerührt, ein Verbot hielt sie nicht für nötig.
In
den folgenden Jahrzehnten bekannten sich nur einzelne Gelehrte zum
eigentlichen Gehalt des Werks. Einer der wenigen, die das
heliozentrische Weltbild akzeptierten, war Johannes Kepler. Um 1600
wirkte er in Prag als Assistent des Astronomen Tycho Brahe. Dieser hielt
unbeirrt an der Erde als Mittelpunkt des Kosmos fest und versuchte,
seine Sicht mit genauen Beobachtungen zu belegen.
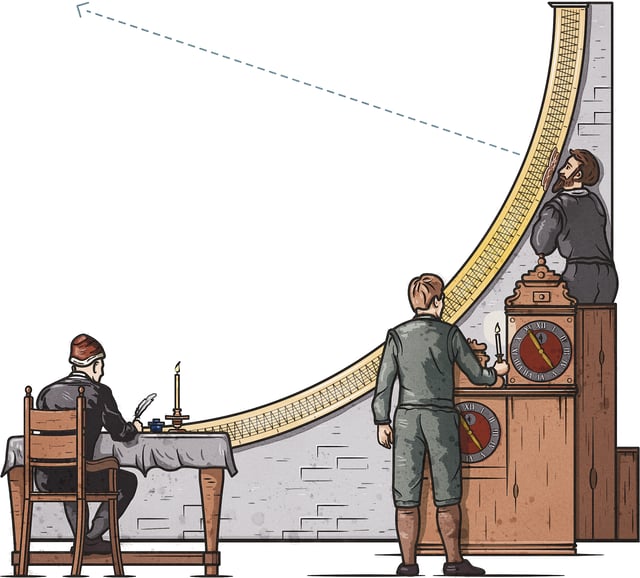 Tycho
Brahe liess riesige Instrumente bauen – darunter ein Quadrant, der von
mehreren Gehilfen bedient wurde. Damit konnte er die Positionen der
Planeten so genau vermessen wie niemand vor ihm.
Tycho
Brahe liess riesige Instrumente bauen – darunter ein Quadrant, der von
mehreren Gehilfen bedient wurde. Damit konnte er die Positionen der
Planeten so genau vermessen wie niemand vor ihm.
Das heliozentrische Weltbild nach Kepler.
Kepler
zeigte, dass die Planeten die Erde nicht in perfekten Kreisen umrunden,
sondern in Ellipsen und dabei ihre Geschwindigkeit variieren. Erst
damit waren Berechnungen möglich, die präzise mit den beobachteten Daten
übereinstimmten.
Der
italienische Universalgelehrte Galileo Galilei wiederum war der Erste,
der das neu entwickelte Fernrohr in den Himmel richtete. Er entdeckte,
dass die Venus durch die Bestrahlung der Sonne Phasen zeigte wie der
Mond – und das war nur dann möglich, wenn sie um die Sonne kreiste.
Diese
und andere Beobachtungen machten Galilei zum unerschütterlichen
Kopernikaner. Er vertrat das heliozentrische Weltbild öffentlich und
forderte, die Heilige Schrift nicht wörtlich zu nehmen: Die Bibel «lehrt
uns, wie man in den Himmel kommt, nicht, wie der Himmel geht», schrieb
er.
Erst
jetzt reagierte die Kirche. Die Inquisition zwang Galilei, seine Worte
zu widerrufen, und stellte ihn unter Hausarrest. «De revolutionibus» kam
1616 auf den Index der verbotenen Bücher, wo es mehr als zweihundert
Jahre blieb.
Das
verhinderte aber nicht den Durchbruch des heliozentrischen Weltbilds,
den die Physik Isaac Newtons schliesslich mit sich brachte. Newton
beschrieb 1687 eine Kraft, die auf der Erde wirkt, aber auch den Kosmos
regiert: die Gravitation. Damit erklärte er die Planetenbahnen als
natürliche Folge eines universellen Gesetzes und verwandelte Kopernikus’
kühne Idee in eine unumstössliche Gewissheit.
Zu
diesem Zeitpunkt war längst auch bekannt, was zunächst nur wenige
geahnt hatten: Das irreführende Vorwort in «De revolutionibus» stammte
nicht von Kopernikus, sondern vom Nürnberger Theologen Andreas Osiander.
Im Auftrag der Druckerei beaufsichtigte er die Herstellung des Buchs
und war auch für die Korrekturen zuständig. Weil er das Werk vor
kirchlicher Kritik schützen wollte, verharmloste er den Inhalt
eigenmächtig. Einerseits sorgte er so dafür, dass das Buch zirkulieren
konnte. Aber andererseits wurde er mit seinem entschärfenden Vorwort zum
heimlichen Bremser der kopernikanischen Wende.
 Alfred Neumann aus Jochen Ebmeiers Realien
Alfred Neumann aus Jochen Ebmeiers Realien