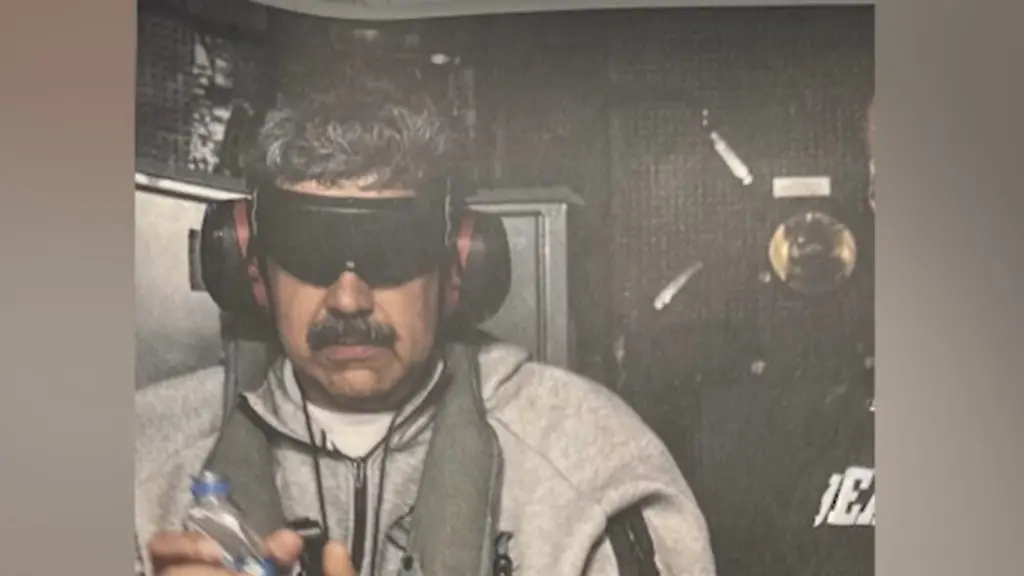aus scinexx.de, 27. Januar 2026 Eine neue Kartierung zeigt die
Verteilung und Dichte Dunkler Materie so genau wie nie zuvor. Die
Konturlinien verbinden Bereiche gleicher Dunkle-Materie-Dichte. zuJochen Ebmeiers Realien
Astronomen haben die Dunkle Materie so genau kartiert wie nie zuvor – und damit das verborgene Gerüst unseres Universums enthüllt. Denn diese unsichtbare, noch immer rätselhafte Materieform beeinflusst, wo Galaxien, Sterne und alle anderen kosmischen Strukturen entstehen. Die mit dem James-Webb-Teleskop erstellte Kartierung zeigt die Dichte und Verteilung dieser unsichtbaren Materieform nun in doppelt so hoher Auflösung wie frühere Karten. Sie enthüllt selbst feinste Filamente, wie das Team in „Nature Astronomy“ berichtet.
Die Dunkle Materie hat die Entwicklung und Struktur unseres Universums entscheidend geprägt. Nach dem Urknall bestimmte ihre Verteilung, wo im Kosmos die ersten Sterne und Galaxien entstanden. Der Schwerkrafteinfluss dieser unsichtbaren Materieform schuf das Grundgerüst für alle großräumigen Strukturen im Universum – von riesigen Galaxienhaufen und Filamenten des kosmischen Netzwerks bis zur Form und Bewegung der kleinsten Galaxien. Entsprechend wichtig ist es, die Verteilung der Dunklen Materie möglichst genau zu erkennen – um beispielsweise kosmologische Modelle zu überprüfen.

Wie kartiert man unsichtbare Materie?
Doch wo sich Dunkle Materie verbirgt, lässt sich nur indirekt ermitteln. Im nahen Umfeld analysieren Astronomen dafür die Bewegung von Sternen oder Galaxien. Für umfassendere Kartierungen nutzen sie winzige Verzerrungen im Licht ferner Galaxien, die durch den Schwerkrafteinfluss von Dunkler Materie zwischen dem Teleskop und den Galaxien entstehen. Über diesen schwachen Gravitationslinseneffekt können sie Rückschlüsse auf die Masse und Verteilung der Dunklen Materie ziehen.
„Allerdings waren die bisherigen Kartierungen auf Basis des schwachen Gravitationslinseneffekts durch ihre Auflösung oder Sensitivität begrenzt, so dass die feineren Dunkle-Materie-Strukturen, die dem kosmischen Netzwerk zugrunde liegen, unsichtbar bleiben“, erklären Diana Scognamiglio vom Jet Propulsion Laboratory der NASA und ihre Kollegen.
800.000 Galaxien im Visier
Für die neue Kartierung richteten die Astronomen die Nahinfrarotkamera (NIRCam) des James-Webb-Weltraumtelekops 255 Stunden lang auf das sogenannte COSMOS-Feld, einen rund 2,5 Vollmonde großen Ausschnitt am Himmelsäquator. „Jahrzehnte der Beobachtungen durch nahezu alle großen Teleskope auf der Erde und im Weltraum haben uns eine umfassende Sicht dieses Felds in allen Wellenlängen geliefert“, erklärt das Team. Das ermöglicht einen guten Vergleich zwischen der Verteilung normaler Materie und Dunkler Materie.
Die neuen Aufnahmen des Webb-Teleskops erfassten rund 800.000 Galaxien im COSMOS-Feld, darunter viele zuvor unbekannte. Im Schnitt erfassten die Astronomen 129 Galaxien pro Quadratbogenminute – so viel wie nie zuvor. Am Licht dieser Galaxien konnten die Astronomen dann die subtilen Effekte der zwischen Teleskop und Galaxien liegenden Dunklen Materie ermitteln.

So genau wie nie zuvor
Das Ergebnis ist eine Karte der Dunklen Materie mit zuvor unerreichter Auflösung. „Sie ist doppelt so scharf wie alle früheren Kartierungen der Dunklen Materie durch andere Observatorien“, sagt Scognamiglio. „Vorher haben wir nur ein verschwommenes Bild der Dunklen Materie gesehen. Jetzt sehen wir dank der unglaublichen Auflösung des Webb-Teleskops das unsichtbare Gerüst des Universums in erstaunlichem Detail.“
Konkret zeigt die neue Dunkle-Materie-Karte die Verteilung der Dunklen Materie in diesem Himmelsausschnitt mit einer Auflösung von rund einer Bogenminute. Das ist gut doppelt so hoch wie die Vorgängerkarte des Hubble-Weltraumteleskops. Die Kartierung enthüllt dadurch nicht nur Ansammlungen Dunkler Materie in Galaxienhaufen und anderen großräumigen Strukturen, sondern auch das Netzwerk der Dunkle-Materie-Brücken, die diese Ansammlungen miteinander verbinden. Sogar feine Filamente und Halos sind sichtbar.
Dunkle Materie – Architekt des Universums
Die neue Karte verrät auch, wie eng normale Materie und Dunkle Materie gekoppelt sind. „Unsere Karte zeigt, wie diese unsichtbare Komponente des Universums die sichtbare Materie strukturiert hat – und so die Entstehung von Galaxien, Sternen und letztlich auch des Lebens ermöglicht hat“, sagt Koautor Gavin Leroy von der Durham University. „Die Karte enthüllt damit die verborgene, aber essenzielle Rolle der Dunklen Materie, des wahren Architekten des Universums.“
Noch umfasst die neue Dunkle-Materie-Karte nur einen kleinen Himmelsausschnitt. Deutlich mehr sollen aber die Kartierungen mithilfe des europäischen Euclid-Teleskops und des künftigen Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskops der NASA zeigen. (Nature Astronomy, 2026, doi: 10.1038/s41550-025-02763-9)
Quelle: Nature Astronomy, Durham University
Nota. - Wenn ich es recht verstehe, ist Dunkle Materie eine solche, die mit anderer Materie nicht interagiert, zum Beispiel nicht mit unseren Messgeräten. Man kann sie nur durch Rückschlüsse aus der Normalmaterie "ermitteln". Aber dennoch bremst sie die Ausdehnung des Universums, dem sie beide angehören.
Wie das? Interagieren nicht ihre individuellen Teilchen mit den individuellen Teil-chen der Normalmaterie, wohl aber 'gravitieren' ihre jeweiligen Gesamtheiten mit einander?
Das wäre ja noch unverständlicher. Eine Infrastruktur, die "da" ist, ohne zu wirken? Aber so müsste es sein, denn immerhin hinterlässt sie Spuren in der Normalmate-rie, aus denen sich Rückschlüsse ziehen lassen.
Oder ließe sich daraus vermuten, dass Gravitation eben doch eine andere Wechsel-wirkung ist als die drei übrigen? Oder wäre sie vielleicht nur so 'leicht' im Vergleich zu den andern Wechselwirkungen, dass dieser quantitativer Unterschied qualititative Folgen hätte? Ein naiver Gedanke, aber doch kein extravaganter.
JE