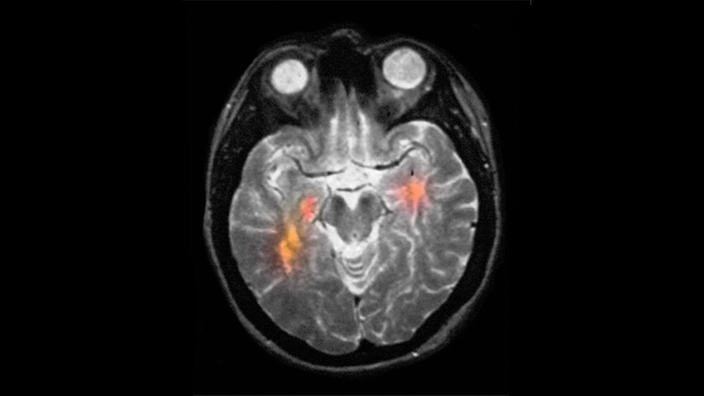aus planet-wissen zu Jochen Ebmeiers Realien
aus planet-wissen zu Jochen Ebmeiers Realien
Das Gehirn mit seinen Milliarden von
Nervenzellen wiegt nur etwa 1,4 Kilo-gramm. Dabei verbraucht es 20
Prozent der Energie unseres Körpers, um die vielfältigen Sinnesreize aus
der Umwelt zu verarbeiten.
Von Hans Jürgen von der Burchard
Was unsere Umgebung an optischen Eindrücken
hinterlässt, sind lediglich Lichtflecken auf dem Augenhintergrund – kein
1:1-Abbild der Realität. Erst nach und nach lernt das Gehirn, diese
"Lichtspiele" zu deuten und speichert Formen, Farben, Gegenstände oder
Gesichter in unterschiedlichen Arealen ab. Jeder neue Seheindruck wird
mit schon bekannten Wahr-nehmungen verglichen.
Ist es ein Stuhl, ein Auto oder ein Mensch? Das
Gehirn entscheidet sich für die wahrschein-lichste Interpretation. Es
erfasst nicht die Welt, so wie sie ist, sondern macht sich sein eige-nes
Bild.
In den meisten Fällen funktioniert das, aber nicht
immer. Wird das Gehirn mit Neuem, Un-gewohntem konfrontiert, werden alle
Ressourcen für die Bewertung benötigt. Und phasen-weise kann dabei der
Denkapparat auch ganz schön durcheinander kommen.
Im Jahre 1946 entwarf der US-Psychologe
und Augenarzt Adelbert Ames einen verblüffen-den Raum. Menschen, die
sich in einem völlig normal erscheinenden Zimmer von einer Ecke in die
andere bewegen, verändern darin scheinbar ihre Größe. Aus Zwergen werden
Riesen und umgekehrt.
Obwohl wir wissen, dass das eigentlich nicht sein kann, erliegen wir der optischen Täu-schung. In Wirklichkeit ist der Ames-Raum völlig schief konstruiert – trapezförmig verzerrt.
Das Gehirn spielt uns einen Streich, weil wir aus
Erfahrung nur rechtwinklige Räume ken-nen. So kommt es zu einer
Fehlinterpretation der Realität.
Jeder kennt das aus eigener Erfahrung. Wir lenken
unsere Aufmerksamkeit auf das, was am wichtigsten erscheint. Alles
andere blenden wir aus, auch wenn sich da einiges tut. Fachleute
sprechen von "change blindness", also "Veränderungsblindheit".
In einem Versuch wurden etwa Passanten von einer
Reporterin gebeten, herauszufinden, welche der beiden Strecken auf einer
Abbildung länger ist. Unter dem Vorwand, einen Maßstab holen zu wollen,
duckte sich die Reporterin hinter ihrem Stand, so dass eine Kollegin
ihre Rolle einnehmen konnte.
Fazit des Versuchs: Die meisten bemerkten den
Reportertausch nicht. Denn das Gehirn hat nur eine begrenzte
Verarbeitungskapazität. Es wirkt wie ein Filter, der eben nicht alles
zum Bewusstsein durchlässt.
Das Gehirn lässt sich nicht auseinandernehmen wie
eine Uhr. Aber dank moderner bild-gebender Verfahren wie der
Kernspintomografie können Forscher den grauen Zellen bei der Arbeit zusehen.
Aktive Nervenzellen
müssen ausreichend mit Blut versorgt werden. Diese Veränderung im
Hirngewebe lässt sich mit Hilfe von Computern sichtbar machen. Sie
verdeutlicht Ort und Ausmaß der Gehirnaktivität.
Wird einer Versuchsperson das Bild eines bekannten
Objekts gezeigt – zum Beispiel ein Auto –, sieht man, welche
Nervenzellen aktiv sind. Andere Nervenzellen springen beim Erkennen von
Gesichtern an. So wissen Forscher inzwischen ziemlich genau, welche
Hirnregionen für die Verarbeitung unterschiedlicher Wahrnehmungen
zuständig sind.
Die Informationsverarbeitung im Gehirn hilft uns,
im Alltag Entscheidungen zu treffen. Es hat gewissermaßen die
individuelle Lebenserfahrung gespeichert und lenkt dementspre-chend unser
Verhalten.
Wer zum Beispiel mit Hunden
immer nur gute Erfahrungen gemacht hat, wird ihnen ver-trauensvoll
begegnen. Wer dagegen schon einmal von einem Hund gebissen wurde, wird
sie eher meiden.
Nicht alles, was die Sinne registrieren, gelangt auch ins Gehirn. Bestes Beispiel ist das Gehör.
Geräusche, Stimmen und Musik erreichen das Ohr als Druckwellen. Aber
nur ein Teil der so übermittelten akustischen Information wird vom
Gehirn verarbeitet. Das Ohr filtert alles Überflüssige aus.
Diese Tatsache haben sich die Entwickler des MP3-Verfahrens zunutze gemacht. Die Bezeichnung MP3 steht für "MPEG Audio Layer
3". Dabei wird entsprechend der begrenzten Wahrnehmung unseres Gehörs
all das aus den ursprünglichen Audiodaten entfernt, was für den
Klangeindruck unbedeutend ist. Dadurch ist es möglich, Musik extrem
kompakt zu speichern, ohne hörbaren Qualitätsverlust.
 El Aqsa brennt zu öffentliche Angelegenheiten
El Aqsa brennt zu öffentliche Angelegenheiten