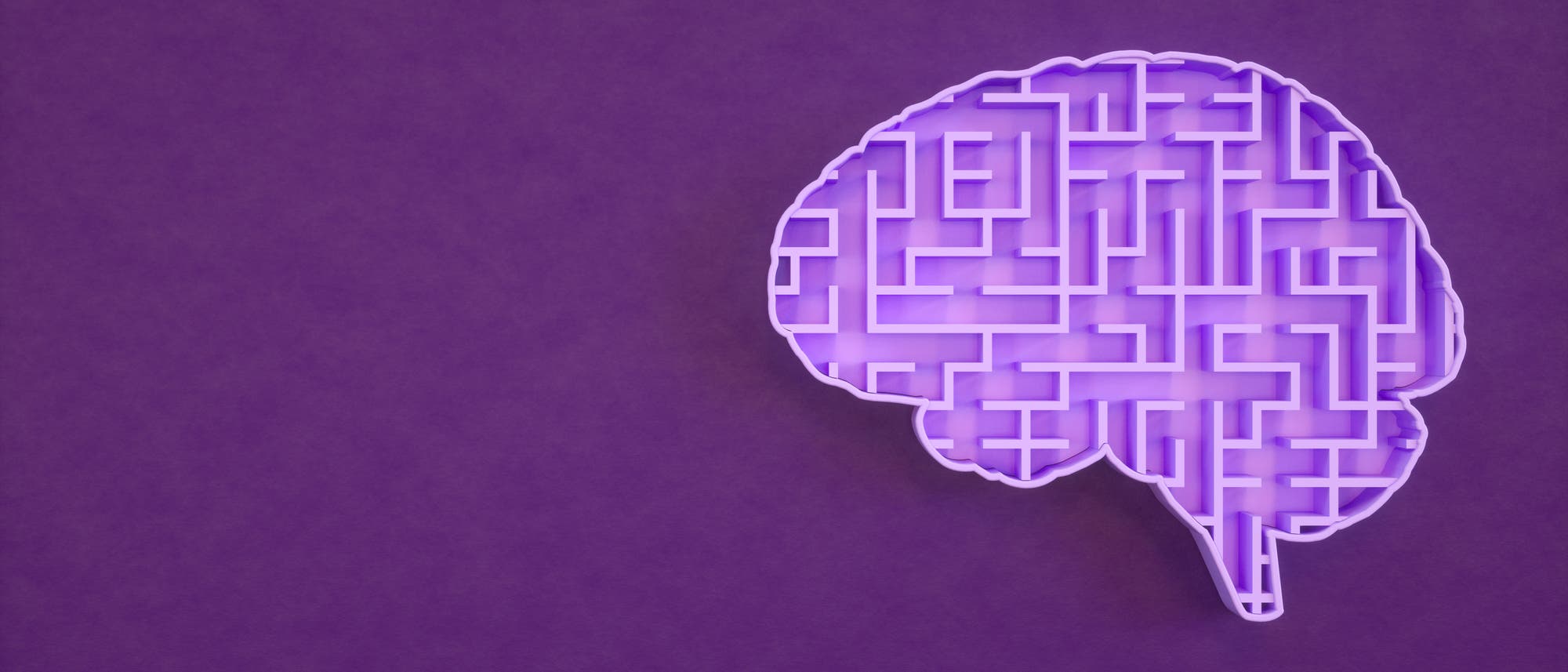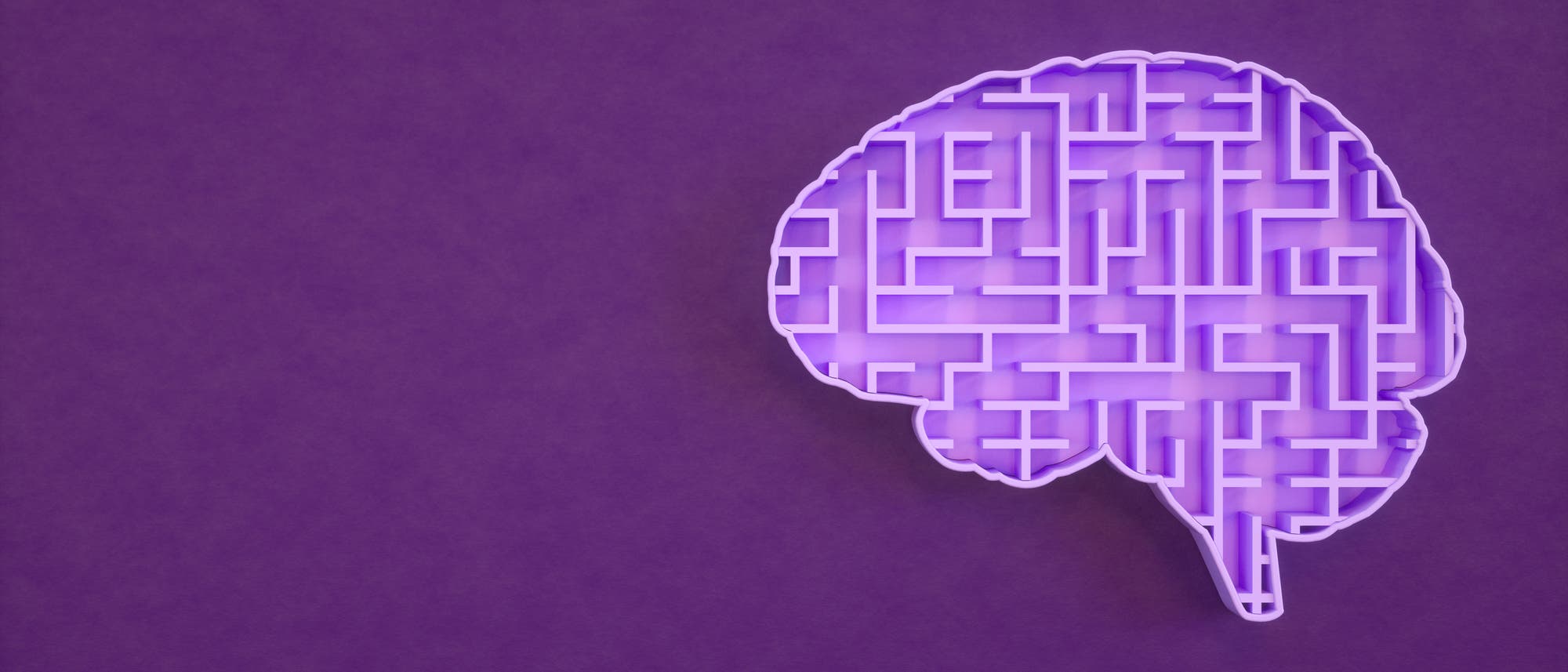
aus spektrum.de, 30.10.2024 Das Gehirn erstellt Karten der Umgebung, anhand derer wir uns
orientieren. So findet man auch dann den Weg, wenn man die genaue
Abfolge der Abbiegungen nicht kennt. zu Philosophierungen, zu ... Realien;
Wie das Gehirn Gedanken und Erinnerungen codiert
Orientierung: »Der innere Kompass dient als Blaupause für höhere Kognition«
Wie
codiert unser Gehirn Gedanken und Erinnerungen? Neurowissenschaftler
Christian Doeller weiß: Es nutzt dafür ein an anderer Stelle bewährtes
System. Jenes zur räumlichen Orientierung. Interview von Anna von Hopffgarten. Herr
Doeller, der Spektrum-Verlag ist gerade in einen neuen, großen
Gebäudekomplex gezogen. In den ersten Tagen liefen wir ziemlich planlos
umher. Jetzt, nach einer Woche, sieht man kaum noch verirrte Kolleginnen
und Kollegen. Was hat sich in der kurzen Zeit im Gehirn verändert?
In Ihrem Gehirn hat sich eine Karte des Gebäudes aufgebaut, quasi ein
dreidimensionaler Grundriss. Während Sie durch die Flure gehen und an
Ihnen bekannten Wegmarken vorbeikommen, etwa an Schildern, besonderen
Zimmerpflanzen oder Bildern, aktualisieren die Nervenzellen immer wieder
Ihre Position in diesem Plan.
Wie ist das möglich?
Im Schläfenlappen des Gehirns liegt die so genannte
Hippocampusformation. Sie ist nicht nur entscheidend für das Gedächtnis,
sondern darin befinden sich auch wichtige Bausteine des körpereigenen
Navigationssystems. Die Ortszellen etwa, die der Brite John O'Keefe 1971
entdeckte, signalisieren die eigene Position im Raum. Für jeden Ort ist
eine andere Ortszelle zuständig: So feuert eine Zelle beispielsweise an
Ihrem Schreibtisch, eine andere am Fenster und wieder eine andere an
der Tür. Von diesen Neuronen gibt es Zehntausende, die alle zusammen den
gesamten Raum abbilden. Ein zweiter Zelltyp, die Gitterzellen, codieren
die Struktur der Umgebung. Eine einzelne Gitterzelle feuert an vielen
verschiedenen Orten, die aber zusammen ein hexagonales Gittermuster
ergeben – deshalb der Name.
 Christian Doeller | Der Psychologe und Neurowissenschaftler promovierte
über die neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens und forschte
anschließend am University College London mit John O'Keefe am
Ortszellsystem von Nagetieren. 2010 wurde er zum Associate Professor am
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour im niederländischen
Nimwegen berufen. Seit 2016 ist er Professor für Neurowissenschaften am
Kalvi Institute for Systems Neuroscience in Trondheim, das von den
Nobelpreisträgern May-Britt und Edvard Moser gegründet wurde. 2018 wurde
Doeller zudem Direktor der Abteilung für Psychologie am
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig
und seit 2019 ist er Professor für Psychologie an der Universität
Leipzig. 2023 wurde er zum Vizepräsidenten der Max-Planck-Gesellschaft
ernannt.
Christian Doeller | Der Psychologe und Neurowissenschaftler promovierte
über die neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens und forschte
anschließend am University College London mit John O'Keefe am
Ortszellsystem von Nagetieren. 2010 wurde er zum Associate Professor am
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour im niederländischen
Nimwegen berufen. Seit 2016 ist er Professor für Neurowissenschaften am
Kalvi Institute for Systems Neuroscience in Trondheim, das von den
Nobelpreisträgern May-Britt und Edvard Moser gegründet wurde. 2018 wurde
Doeller zudem Direktor der Abteilung für Psychologie am
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig
und seit 2019 ist er Professor für Psychologie an der Universität
Leipzig. 2023 wurde er zum Vizepräsidenten der Max-Planck-Gesellschaft
ernannt.
Welchen Zweck erfüllt dieses Gitter?
Als Ergänzung zu den Ortszellen, die ganz spezielle Stellen im Raum
codieren, repräsentieren die Gitterzellen eine Art Metrik der Umgebung.
Da verschiedene Gitterzellen, versetzt zueinander, unterschiedliche,
sich teils überlappende hexagonale Muster erzeugen, kann das Gehirn mit
Hilfe von zehntausenden Neuronen dieser Art Distanzen messen und die
eigene Orientierung im Raum feststellen.
Für
die Entdeckung der beiden Zelltypen gab es vor zehn Jahren, 2014, den
Nobelpreis. Das norwegische Ehepaar May-Britt und Edvard Moser, das 2005
die Gitterzellen fand, erhielt ihn gemeinsam mit John O'Keefe vom
University College London. Sie haben mit allen dreien
zusammengearbeitet.
Ja. Ab 2004 habe ich meinen Postdoc am University College in London gemacht. 2016 bin ich dann zum Kalvi Institute for Systems Neuroscience
im norwegischen Trondheim gekommen und dort zum Professor berufen
worden. Die Mosers hatten das Institut 20 Jahre zuvor gegründet.
Genügt die Arbeit der Orts- und Gitterzellen, um sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden?
Es gibt noch eine ganze Menge anderer räumlich sensitiver Zellen im
Gehirn, die uns beim Navigieren unterstützen. Die Kompasszellen, auf
Englisch »head direction cells«, etwa zeigen die Richtung an, in die der
Kopf gedreht ist – und damit die Laufrichtung. Die
Geschwindigkeitszellen codieren die Laufgeschwindigkeit und die
Grenzzellen die Distanz zu einer Wand. Die »object vector cells«
wiederum geben an, in welcher räumlichen Position wir uns relativ zu
Objekten in unserer Umgebung befinden. Alle zusammen bilden das
Navigationssystem des Gehirns, das eine interne kognitive Karte erzeugt.
Die
Zelltypen hat man allesamt bei Ratten oder Mäusen, also Nagetieren,
entdeckt. Gibt es sie auch beim Menschen? Schließlich kann man hier in
der Regel nicht so genau nachsehen.
Das stimmt. Bei
Mäusen und Ratten kann man mit Elektroden die Aktivität einzelner Zellen
erfassen. Und bei anderen Säugetieren wie Fledermäusen und Rhesusaffen
wurden mit diesem Verfahren ebenfalls Zellen des Navigationssystems
gefunden. Solche Einzelzellableitungen sind bei Menschen aber in der
Regel nicht möglich, außer in seltenen Ausnahmefällen: wenn man etwa bei
Epilepsiepatienten versucht, mit implantierten Elektroden den Herd der
Krampfanfälle zu lokalisieren. Auf diese Weise haben Fachleute
tatsächlich Ortszellen im menschlichen Hippocampus entdeckt. Wir
arbeiten dagegen nicht invasiv, das heißt mit funktioneller
Magnetresonanztomografie (fMRT) oder Magnetoenzephalografie (MEG). Und
auch damit haben wir Hinweise auf ein vergleichbares Navigationssystem
beim Menschen gefunden.
TV-Tipp
»SCOBEL – Wie wir uns orientieren«
Christian
Doeller im Gespräch mit Gert Scobel und weiteren Experten. Die Sendung
entstand in redaktioneller Zusammenarbeit mit »Gehirn&Geist« und dem
NeuroForum Frankfurt 2024 der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Auf 3sat am 14.11.2024 um 21 Uhr.
Solche
nicht invasiven Messmethoden haben ja meist eine sehr geringe räumliche
Auflösung. Wie können sie dennoch Erkenntnisse zur Arbeit einzelner
Neurone liefern?
Die fMRT erfasst die neuronale
Aktivität tatsächlich nur indirekt über die Veränderung des
Sauerstoffgehalts des Bluts. Man nennt das »hämodynamisches Signal«. Die
heute gängigen Tomografen bilden Volumenelemente mit einer Kantenlänge
zwischen einem und drei Millimetern ab. Selbst bei der höchstmöglichen
Auflösung betrachtet man daher immer die mittlere Aktivität von
zehntausenden Zellen. Möchte man nun neuronale Codes messen, was in der
kognitiven Neurowissenschaft gang und gäbe ist, muss man mit Modellen
arbeiten. Wir überlegen uns, wie die Aktivität einer ganzen Population
von Nervenzellen aussehen könnte und wie sich das im hämodynamischen
Signal widerspiegelt: Was zeigt der Kernspintomograf an, wenn
10 000 Zellen gleichzeitig feuern?
»Die funktionelle Magnetresonanztomografie ist die Methode der Wahl für unsere Forschung«
Wahrscheinlich passiert das eher selten, dass alle 10 000 Zellen in einem Kubikmillimeter Hirngewebe gleichzeitig feuern, oder?
Genau das ist die Schwierigkeit: wenn die eine Zelle etwas anderes
macht als die benachbarte. Dann sehen wir womöglich gar keinen Effekt.
Die Gitterzellen bieten aber den Vorteil, dass sie ein regelmäßiges
Feuerverhalten aufweisen, also an vorhersehbaren Stellen im Raum aktiv
werden. Über alle Neurone hinweg ist die Orientierung des Gittermusters
konstant, und das können wir für die Analyse nutzen. Trotz aller
Herausforderungen ist die funktionelle Magnetresonanztomografie die
Methode der Wahl für unsere Forschung, sozusagen unser Arbeitspferd.
Es
gibt zunehmend Hinweise darauf, dass das Navigationssystem im Gehirn
noch ganz andere Aufgaben hat, als uns von A nach B zu führen. Welche?
Meine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissen-schaften
in Leipzig und andere Teams gehen davon aus, dass die
Hippocampus-formation das Orts- und Gitterzellsystem auch für völlig
andere kognitive Bereiche einsetzt.* Ein Beispiel ist das Konzeptlernen.
Wenn wir Dinge anhand gemeinsa-mer Eigenschaften gedanklich in Klassen
oder Konzepte zusammenfassen, nutzt das Gehirn dafür eine räumliche
Codierung. Wir sprechen auch von »kognitiven Räumen«. So stellt jede
Eigenschaft eine Dimension dar, entlang derer sich ein kog-nitiver Raum
aufspannt. Objekte von ähnlicher Beschaffenheit liegen in dieser
men-talen Karte nah beieinander und solche, die sich stark unterscheiden,
weit voneinan-der entfernt.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir mal Autos. Unser Wissen darüber ist multidimensional, das
heißt, man kann Fahrzeuge entlang ganz verschiedener Dimensionen
anordnen: Gewicht, Motorstärke, Anzahl an Sitzen, Preis und so weiter.
Ein Familienvater achtet beim Kauf vielleicht besonders auf den Preis
und die Anzahl der Plätze. Im kognitiven Raum ist jede
Merkmalskombination an einem bestimmten Ort positioniert. Ein günstiges
Auto mit wenigen Sitzen ist in diesem Raum weit entfernt von einem
teuren Van. Das Konzeptlernen ist aber nur eines von vielen Beispielen
dafür, was die Orts- und Gitterzellen alles leisten. Wir nehmen an, dass
mit ihrer Hilfe jegliche Informationen im Gehirn repräsentiert werden,
die man entlang von Dimensionen darstellen kann. Der innere Kompass
dient quasi als Blaupause für höhere kognitive Funktionen.
»Studien haben gezeigt, dass das Gehirn soziale Beziehungen ebenfalls in kognitiven Karten codiert«
Studien zufolge sollen sogar soziale Beziehungen im Gehirn räumlich codiert sein. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau wie Fahrzeuge kann man auch seine Mitmenschen je nach Eigenschaft
und sozialem Verhältnis entlang von Dimensionen anordnen. Bei Kollegen
sind es beispielsweise die hierarchische Position im Unternehmen und die
Nähe zum eigenen Tätigkeitsbereich. Bei Freunden achten wir vielleicht
mehr darauf, wie eng das Verhältnis ist und wie sehr sich die Interessen
ähneln. Studien haben gezeigt, dass das Gehirn solche sozialen
Beziehungen ebenfalls in kognitiven Karten codiert.
Was ist so vorteilhaft an diesem Organisationsprinzip, dass es sich im Lauf der Evolution durchgesetzt hat?
Das Orts- und Gitterzellsystem hat den entscheidenden Vorteil, dass es
komplexe, multidimensionale Informationen – also solche mit ganz vielen
verschiedenen Eigenschaften – in Räumen mit wenigen Dimensionen
repräsentiert. So kann das Gehirn sehr viele Elemente und deren
Verhältnis zueinander abspeichern. Zugleich ist das System sehr
dynamisch. Ursprünglich diente es dazu, dass sich Tiere in ihrer
Umgebung zurechtfinden. Und hierbei ist Flexibilität natürlich
entscheidend. Die Ortszellen etwa repräsentieren einen ganz spezifischen
Ort in einer bestimmten Umgebung. Zelle A feuert beispielsweise an der
Tür eines Raums und Zelle B am Fenster. Gehen wir nun aber in einen
anderen Raum, bildet sich im Gehirn sofort eine neue Karte. Jetzt ist
Zelle A plötzlich in der Zimmermitte aktiv und Zelle B womöglich gar
nicht mehr. Dafür schaltet sich hier eine Zelle C hinzu, die wiederum
einen anderen Ort in dem Raum codiert. Eine derartige
Anpassungsfähigkeit ist auch nützlich für höhere kognitive Aufgaben, die
mit räumlicher Navigation nichts zu tun haben, etwa das Konzeptlernen.
Außerdem ermöglicht es dieses Organisationsprinzip, Gelerntes zu
generalisieren, also auf neue Situationen zu übertragen, was ebenfalls
entscheidend fürs Überleben ist.
Für die Generalisierung von Wissen sind die Ortszellen bestens
geeignet, weil sie strukturelle, ja beinahe semantische Informationen
codieren. Ich gehe hier in Leipzig fast immer in denselben Supermarkt.
Wenn ich aber mal in einem anderen bin, weiß ich trotzdem, wo ich welche
Produkte finde. Warum? Weil fast alle Supermärkte nach dem gleichen
Prinzip aufgebaut sind: Das Obst befindet sich in der Regel kurz hinter
dem Eingang, der Käse im Kühlregal im hinteren Bereich des Ladens und
die Kaugummis an der Kasse. Diese strukturellen Informationen sind in
meinem Gitterzellsystem gespeichert. Und das gilt auch für nicht
räumliches Wissen: Wenn ich mich beispielsweise mit
Verwandtschaftsverhältnissen auskenne, brauche ich nicht viele
Informationen über einen Menschen, um zu folgern, dass seine Mutter
gleichzeitig die Großmutter seiner Nichte ist.
Was
bedeutet das für die Art und Weise, wie wir lernen? Viele sind davon
überzeugt, dass wir uns Lernstoff am besten anhand von Bildern und Fotos
einprägen können. Sind Diagramme und Zeitleisten womöglich besser
geeignet, weil sie Beziehungen in Raum und Zeit veranschaulichen,
ähnlich wie unser Gehirn?
Ich denke tatsächlich, dass
eine räumliche Anordnung von Lerninhalten für dieses interne
Kartensystem besonders gut geeignet ist. Manchmal macht man das ja sogar
intuitiv: Wir arrangieren Vokabeln räumlich nach ihrer Bedeutung oder
zeichnen komplexe Zusammenhänge grafisch auf, um Beziehungen zu
erkennen.
»Das Gehirn bietet meist mehrere parallele Verarbeitungswege, um das Gleiche zu erreichen«
Manche
Menschen können sich besser im Raum orientieren, andere schlechter.
Wenn wir das innere Navigationssystem auch für höhere kognitive Aufgaben
nutzen, drängt sich die Frage auf, ob Personen mit gutem
Orientierungssinn entsprechend leichter neue Konzepte lernen oder
soziale Gefüge durchschauen.
Leider ist die Studienlage
dazu noch nicht so klar. Aber ich nehme an, dass Sie Recht haben: Je
effizienter das Gitterzellsystem allgemein strukturelle Informationen
repräsentiert, desto besser sollte ich auch in der Lage sein, dieses
Wissen zu übertragen – ob beim Navigieren durch eine neue Umgebung oder
beim Erschließen von Verwandtschaftsverhältnissen. Wie alles in der
Neurowissenschaft ist das natürlich sehr kompliziert. Denn es ist selten
nur ein einzelnes System für eine bestimmte Funktion zuständig; das
Gehirn bietet meist mehrere parallele Verarbeitungswege, um das Gleiche
zu erreichen. Im Fall der Navigation gibt es zum Beispiel noch weitere
neuronale Strukturen jenseits des Hippocampus, die uns von A nach B
kommen lassen.
Ganz ohne kognitive Karte?
Ja. Man kann einerseits den Weg vom Parkplatz zum Museum finden,
indem man eine kognitive Karte der Stadt aufbaut. Man kann sich aber
auch einfach merken: zweimal rechts, dreimal links, dann bin ich am
Ziel. Dafür braucht man keine Orts- und Gitterzellen. Sobald aber
plötzlich eine Baustelle den Weg versperrt und ich eine Umleitung finden
muss, bin ich mit der Strategie, mir die Abbiegungen zu merken,
aufgeschmissen. Dann brauche ich wieder eine mentale Karte.
Aktuell
wird sehr viel Aufwand in die Entwicklung künstlicher Intelligenz
gesteckt. Man orientiert sich dabei gerne an der Arbeitsweise des
menschlichen Gehirns. Kann das Wissen, dass es Informationen in
kognitiven Räumen abspeichert, hier helfen?
Vielfach
haben sich KI-Entwickler vom menschlichen Gehirn inspirieren lassen.
Dennoch gibt es einige Bereiche der Kognition, die nicht so einfach zu
simulieren sind. Vor allem jene neuronalen Prozesse, die den höchsten
kognitiven Funktionen zu Grunde liegen, können der KI-Forschung aber als
Vorbild dienen – etwa das Gitterzellsystem, wenn es darum geht,
Gelerntes zu generalisieren und auf neue Situationen zu übertragen. Man
darf allerdings nicht vergessen, dass es sich hier um technische
Wissenschaften handelt. Wenn die beste künstliche Intelligenz biologisch
unplausibel operiert, dann werden die großen Unternehmen diesen Weg
sicherlich trotzdem weiterverfolgen.
Der Sitz der
Ortszellen ist auch jener, der von der Alzheimerdemenz als Erstes
betroffen ist. Könnte man die Erkenntnisse zum inneren Navigationssystem
nutzen, um die Krankheit früher zu diagnostizieren?
Tatsächlich versuchen wir das. Es gibt Hinweise aus dem Tiermodell, dass
die Orts- und Gitterzellen bei Mäusen mit Morbus Alzheimer weniger
effizient arbeiten. Ortszellen codieren den Raum sehr präzise, das
heißt, ein Neuron feuert nur innerhalb eines Zehn-Zentimeter-Bereichs.
Bei den Alzheimermäusen ist diese Grenze unschärfer. Das ist ein
bisschen so, wie wenn eine kurzsichtige Person die Brille abnimmt. Das
Gleiche gilt für die Gitterzellen. Unsere Arbeitsgruppe hat zudem
menschliche Probanden untersucht, die laut Genanalysen ein erhöhtes
Risiko für Alzheimer aufweisen. Bei ihnen fiel das Signal der
Gitterzellen allgemein schwächer aus – zumindest deuteten indirekte
MRT-Messungen darauf hin. Andere Teams untersuchen gerade das
Gitterzellsystem von Patienten, die bereits an Alzheimer erkrankt sind.
Vielleicht handelt es sich hier um einen frühen Biomarker, mit dem man
die Krankheit zeitig erkennen kann. Die Forschung dazu ist in vollem
Gange, wir wissen also noch nicht, ob das funktioniert.
Wird das Orts- und Gitterzellsystem mit dem Alter generell weniger leistungsfähig?
Das scheint in gewissem Maße so zu sein. Allgemein wird man mit dem
Alter etwas vergesslicher und findet weniger gut den Weg von A nach B.
Zumindest gibt es eine leichte Verlagerung im Gehirn: Man nutzt offenbar
für die Orientierung zunehmend weniger das Hippocampussystem, dafür
aber vermehrt Strategien, für die andere Hirnbereiche zuständig sind. Ob
das auch für die höhere Kognition gilt, ist aber noch unklar.
*Nota. - Der hermeneutisch orientierte Philosoph Paul Gf. Yorck von Wartenburg hat den Begriff der Bewusstseinsstellung zur Unterscheidung der Kulturepochen eingeführt. Er stellt namentlich die "okulare" Bewusstseins-stellung der Inder und Griechen der "Verräumlichung" des Bewusstseins in der europäischen Neuzeit gegenüber, für die er Descartes verantwortlich macht; dazwischen läge das "christlich-antike Amalgam" des katholische Mittelalters. Wie weit seine Epochen-Einteilung trägt, ist ein Thema für sich. Seine Phänomenologie der modernen Räumlichkeit ist dagegen ganz plau-sibel.
Die Frage wäre nun: Würden Christian Doellers Untersuchungen zu kog-nitiven Räumen dieselben Ergebnisse zeitigen, wenn er sie in außereuropä-ischen und vormodernen Kulturen durchführte? Nach Gf. Yorck sollten sie das eigentlich nicht.
JE