aus spektrum.de, 22. 9. 2023 zu Jochen Ebmeiers RealienWas tut unser Hirn, Wenn wir nichts tun?
Die Aktivität unseres Gehirns während spezifischen Denkprozessen zu verstehen ist das zentrale Ziel der kognitiven Neurowissenschaften. Doch was spielt sich in unserem Hirn ab, wenn gerade keine genaue Aufgabe vorliegt? Was passiert, wenn wir uns nicht einem äußeren Reiz zuwenden, sondern stattdessen nach innen sehen?
von Florian Walter
Um zu klären, welche Aktivität unser Gehirn im Ruhezustand aufweist, müssen wir erst einmal verstehen, wie dies erforscht werden kann. Verfahren, die uns erlauben, von außen in den Körper zu blicken und etwa Abbildungen des Gehirns zu erhalten, nennt man bildgebende Verfahren. Zu diesen Methoden gehört etwa die Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie (MRT). Diese Verfahren spielen eine zentrale Rolle in der Medizin, wenn beispielsweise Hirnverletzungen oder Tumore untersucht werden müssen. Seit ihrer Erfindung wurden diese Techniken kontinuierlich erweitert und verbessert. Eine zentrale Errungenschaft in der bildgebenden Verfahrenstechnik für die Neurowissenschaften ist die Nutzung von Sauerstoff als endogenes Kontrastmittel in der MRT-Bildgebung. Dies bedeutet, dass moderne MRT-Technik uns erlaubt, mit hoher räumlicher Präzision einzuschätzen, welche Hirnareale mit wie viel sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Wird dabei ein Hirnareal mehr versorgt als andere, können wir daraus schließen, dass dieses Areal gerade besonders aktiv ist, da hier nun mehr verstoffwechselt wird als sonst. Diese Art von Bildgebung, bei der nicht nur ein Bild des Gehirns aufgenommen wird, sondern die Aktivität über einen gewissen Zeitraum hin gemessen wird, nennt man funktionale Bildgebung (statt der strukturellen Bildgebung) [1].
Die Variante der MRT, die Veränderungen im sauerstoffreichen Blut betrachtet, nennt man funktionales MRT (fMRT) und ist neben Methoden wie dem EEG oder dem PET-Scan das zentrale Werkzeug der kognitiven Neurowissenschaften. Die kognitiven Neurowissenschaften sind ein relativ junges Feld, welches eine Art Bindeglied zwischen Psychologie und Neurowissenschaften darstellt. Hier werden kognitive Tests, wie man sie etwa aus der Neuropsychologie kennt (siehe Hirn und weg vom 24.08.2023), mit funktionaler Bildgebung kombiniert. So soll ermittelt werden, welche Areale für bestimmte psychologische Funktionen zuständig sind. Beispielsweise gibt es Areale auf der menschlichen Hirnrinde, die mit der Aufmerksamkeit verbunden sind, Areale, die für Sprachprozesse zuständig sind oder andere, die mit dem Kurzzeitgedächtnis in Verbindung gebracht werden.
In solchen Experimenten der kognitiven Neurowissenschaften werden meist zweierlei Messungen angestellt. Einmal wird das Hirn aufgenommen, während die Aufgabe oder der Test durchgeführt wird. Zudem werden aber auch Messungen der Hirnaktivität gemacht, ohne dass die Teilnehmenden eine genaue Aufgabe haben. Dies diente ursprünglich vor allem dem Zweck, einen genaueren Eindruck der für die Aufgabe relevanten Areale zu erhalten. Auf diese Weise kann nämlich von der „Aufgabenaktivität“ die „Grundaktivität“ abgezogen werden. So wird ein gewisses Grundrauschen aus der Rechnung herausgenommen und vermieden, dass Hirnaktivität, die nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun hat, die Ergebnisse verzerrt. Jedoch brachte diese Herangehensweise einen weiteren Aspekt der Hirnaktivität zu Tage, welcher eigentlich kein Ziel der ersten kognitiven neurowissenschaftlichen Experimente war: Im wachen Ruhezustand sind einige Hirnareale aktiver, als wenn ein klares Ziel verfolgt wird [2]!

Hirnaktivität im Ruhezustand
Um diese Ergebnisse besser zu verstehen, wurde ein neues Paradigma eingeführt: Das resting-state imaging, oder auf Deutsch, die Bildgebung im Ruhezustand. Hierbei werden die Methoden der funktionalen Bildgebung genutzt, um im Ruhezustand aktive Hirnareale zu finden. Teilnehmende würden also im Scanner keine Aufgaben lösen, sondern einfach die Augen schließen oder ihren Blick auf einen vorgegebenen Punkt fixieren. Es zeigt sich, dass, ähnlich wie bei höheren kognitiven Funktionen, stets mehr als ein Hirnareal aktiv ist. Die Aktivität in diesen Arealen ist sich dabei oft sehr ähnlich, weshalb man die Areale zu Netzwerken zusammenfasst. Es wurden einige dieser Ruhezustands-Netzwerke gefunden, das wahrscheinlich wichtigste und wissenschaftlich am genausten beschriebene dieser Netzwerke ist das default mode network (DMN) [3].
Zuerst beschrieben wurde dieses Netzwerk von Gordon Shulman und seinem Team [4], die in einem PET-Scan Experiment feststellten, das die Areale des DMN während zielgerichteten kognitiven Aufgaben ihre Aktivität verringerten. Bestärkt wurden diese ersten Ergebnisse von den PET-Untersuchungen von Marcus E. Raichle [5], der wie Shulman an der University of Washington tätig ist. Die Experimente wurden in späteren fMRT- und EEG-Experimenten mehrfach wiederholt. Auch mit diesen Verfahren wurde mehrfach gezeigt, dass die verschiedenen Hirnareale im DMN eng verknüpfte Aktivität aufweisen und Veränderungen innerhalb dieses Netzwerkes meist gleichzeitig erfolgen. Das DMN konnte also mit verschiedenen Methoden und mittlerweile auch sehr vielen verschiedenen Teilnehmenden gefunden werden. Aus diesen Gründen gilt es als sehr gut gesichertes Ergebnis und sozusagen als die Nulllinie der menschlichen Hirnaktivität. Interessanterweise wurden Netzwerke in Affen und Nagern beschrieben, die dem DMN sehr ähnlich sind. Es wird deshalb vermutet, dass es sich um ein speziesübergreifendes Phänomen handelt [2].
Aber wo genau befindet sich denn nun dieses Netzwerk und wozu ist es eigentlich gut?
Räumlich erstreckt sich das DMN über weite Teile der Hirnrinde und umfasst dabei Areale auf dreien der vier Hirnlappen, nämlich dem Parietal-, Temporal- und Frontallappen. Wichtig ist dabei, dass die Areale des DMN stets abseits von den Hirnarealen liegen, die mit direkten sensorischen Eindrücken beschäftigt sind, also klar abgegrenzt von der primären Sinneswahrnehmung [6].
Was die Funktionen des DMN angeht, ist die Frage etwas komplizierter. Schon Shulman und Raichle vermuteten, dass es sich bei den Funktionen des DMN wahrscheinlich um selbst-referentielle Gedanken handele [4, 5]. Das ist natürlich ein spannender Ansatz, da es uns einen Anhaltspunkt dafür geben würde, wie ein so komplexer gedanklicher Prozess wie das Nachdenken über uns selbst in unserem Hirn funktionieren könnte. Ein australisches Team von Forschenden um den kognitiven Neurowissenschaftler Christopher Davey untersuchte diese Hypothese genauer und verglich die fMRT-Aktivität im Ruhezustand mit der Aktivität, die auftrat, wenn man die Teilnehmenden bat, Aufgaben zu erfüllen, die zu selbst-referentiellem Nachdenken anregen sollten. So wurden die Teilnehmenden etwa gebeten, zu entscheiden, ob verschiedene Adjektive ihren eigenen Charakter gut beschreiben würden oder nicht. Gezeigt wurde dabei, dass wichtige Kernregionen des DMN nicht nur im Ruhezustand aktiv sind, sondern während selbst-referentiellen Aufgaben ihre Aktivität sogar noch weiter erhöhen [7]. Interessanterweise waren dies auch die Regionen im DMN, die am besten mit anderen Hirnregionen vernetzt sind, man nennt diese Areale auf der Hirnrinde auch Hubs. Sie sind also bestens vernetzt mit anderen Hirnsystemen, etwa mit solchen, die für das Abrufen von Erinnerungen oder für emotionale Prozesse zuständig sind [6, 7].

Auf Basis dieser Ergebnisse gehen die Forschenden um Professor Davey davon aus, dass es sich bei dem DMN um ein Hirnsystem handeln könnte, welches es uns erlaubt, uns bewusst selbst wahrzunehmen. Diese Hypothese hat zwar einigen Rückhalt, doch mehr Forschung wird von Nöten sein, um sie abschließend zu belegen. Dies liegt daran, dass es sich bei Messungen von funktionaler Hirnaktivität meist um sehr kleine Effekte handelt und deshalb Wiederholungen an mehr Menschen, sogenannte Replikationen der Ergebnisse, ein zentraler Bestandteil des Forschungsprozesses sind.
Dennoch ist dies ein höchst spannendes Ergebnis, welches natürlich eine weitere Frage aufwirft:
Was passiert, wenn sich die Aktivität im DMN verändert?
Da dem DMN ja so grundlegende Funktionen zugeschrieben werden, wie unsere Selbstwahrnehmung als Mensch, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie verringerte oder erhöhte Aktivität im DMN sich auf uns auswirken könnte. Um diese Frage zu beantworten, kann man sich beispielsweise Krankheiten ansehen, die sich auf die DMN-Aktivität auswirken. So ist es zum Beispiel so, dass die Aktivität im DMN bei Betroffenen der Alzheimer-Demenz gestört ist. In anderen Worten werden die Verbindungen zwischen den verschiedenen DMN-Arealen schlechter. Dies könnte uns dabei helfen, die Alzheimer Demenz besser zu verstehen und zu erklären, wie sich die Erkrankung auf die Selbst-wahrnehmung der Betroffenen auswirkt. Allerdings heißt dies nicht, dass Alzheimer in erster Linie eine Erkrankung von Netzwerken der Hirnrinde ist. Betroffen sind bei Alzheimer durchaus auch Areale außerhalb des DMN. Zudem könnte eine andere Erklärung für die hohe Betroffenheit des DMN sein, dass DMN-Areale einfach zu den aktivsten im Hirn zählen, weshalb sich die für Alzheimer relevanten Proteine dort früher ablagern als anderswo im Gehirn. Jedoch gab es auch Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass das DMN bei jüngeren Menschen, die genetische Risikofaktoren für Alzheimer-Demenz tragen, aktiver ist, was evtl. dabei helfen könnte, die Erkrankung schon viele Jahre vor den ersten Symptomen zu erkennen. Aus diesem Grund wird das DMN mit Sicherheit weiterhin ein wichtiges Thema in der Alzheimerforschung bleiben [3].
Eine weitere Krankheit, bei welcher das DMN gestört wird, ist die Schizophrenie. Dies erscheint intuitiv erst einmal sehr logisch, da sich die Schizophrenie häufig stark auf das Ich-Erleben der Betroffenen auswirkt. Allerdings ist bei diesem Störungsbild noch unklar, wie genau der Effekt auf das DMN aussieht. So finden einige Studien eine Erhöhung der Aktivität, während andere verringerte Aktivität im Vergleich zu gesunden Teilnehmenden finden. Klar ist jedoch, dass auch diese Erkrankung sich auf die Stärke der Verbindungen zwischen den DMN-Arealen und vom DMN zu anderen Netzwerken auswirkt [3, 8]. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, endet die Liste der Krankheiten, bei denen das DMN involviert ist hier nicht. Auch bei Depressionen, der bipolaren Störung und der Parkinson’schen Erkrankung wurde bereits diskutiert, inwiefern das DMN in Mitleidenschaft gezogen wird.
Neben neuropsychiatrischen Erkrankungen gibt es auch Substanzen, die eine starke Wirkung auf das DMN haben. Allen voran wären hier die klassischen Psychedelika, wie LSD, DMT oder das in vielen Pilzen vorhandene Psilocybin zu nennen. Diese Drogen können während der Dauer ihrer Wirkung die Aktivität im DMN verändern. Auch dies wirkt intuitiv schlüssig, da die Wirkung dieser Substanzen oft mit einer verringerten Selbstwahrnehmung in Verbindung gebracht wird. Spezifisch verringern die Psychedelika die Stärke von Verbindungen innerhalb des Netzwerks, während die Verknüpfungen der DMN-Areale zu anderen Hirnarealen und Hirnnetzwerken vorrübergehend gestärkt werden [9]. Man spricht hier oft davon, dass diese Substanzen die internetwork-connectivity oder auch das globale Netzwerk stärken. Viele Forschende vermuten, dass dieser Effekt zentral für die therapeutischen Wirkungen dieser Substanzen sein könnte, auch wenn dies nicht der einzige relevante Wirkmechanismus der Psychedelika ist. Wichtig ist hierbei vor allem, dass bei Störungen wie der Depression die Verbindungen innerhalb des DMN oft stärker sind, als die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Hirnnetzwerken [9, 10]. Somit könnte die antidepressive Wirkung von Psychedelika gut erklärbar sein, da diese ja einen entgegengesetzten Effekt haben und die Verknüpfungen zwischen Netzwerken stärken und somit eventuell freiere und weniger negative Gedanken zulassen. Auch hier ist aber noch viel Forschung notwendig.
Fazit
Das DMN ist ein wichtiges Hirnnetzwerk, dass für unser Erleben als Menschen eine grundlegende Rolle zu spielen scheint. Es ist involviert in Gedanken, die wir uns über uns selbst machen und eine Störung dieses Netzwerkes kann schwerwiegende Folgen haben. Einige Substanzen scheinen in der Lage zu sein, das Netzwerk zu regulieren und uns somit bei verschiedenen Erkrankungen der Psyche Linderung zu verschaffen. Dennoch verstehen wir dieses grundlegende Hirnnetzwerk, wie so vieles in unseren Köpfen, noch lange nicht vollständig. Der Forschungszweig des resting-state functional imaging hat also noch viele spannende Erkenntnisse zu bieten, die uns hoffentlich dabei helfen werden, uns selbst besser zu verstehen.
Literaturverzeichnis
[1] Raichle M. E.: A brief history of human brain mapping. Trends in neurosciences 32, 118–126 (2009).
[2] Raichle M. E.: The brain’s default mode network. Annual review of neuroscience 38, 433–447 (2015).
[3] Rosazza C., Minati L.: Resting-state brain networks: literature review and clinical applications. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology 32, 773–785 (2011).
[4] Shulman G. L., Fiez J. A., Corbetta M., Buckner R. L., Miezin F. M., Raichle M. E., Petersen S. E.: Common Blood Flow Changes across Visual Tasks: II. Decreases in Cerebral Cortex. Journal of cognitive neuroscience 9, 648–663 (1997).
[5] Raichle M. E., MacLeod A. M., Snyder A. Z., Powers W. J., Gusnard D. A., Shulman G. L.: A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98, 676–682 (2001).
[6] Smallwood J., Bernhardt B. C., Leech R., Bzdok D., Jefferies E., Margulies D. S.: The default mode network in cognition: a topographical perspective. Nature reviews. Neuroscience 22, 503–513 (2021).
[7] Davey C. G., Pujol J., Harrison B. J.: Mapping the self in the brain’s default mode network. NeuroImage 132, 390–397 (2016).
[8] Hu M.-L., Zong X.-F., Mann J. J., Zheng J.-J., Liao Y.-H., Li Z.-C., He Y., Chen X.-G., Tang J.-S.: A Review of the Functional and Anatomical Default Mode Network in Schizophrenia. Neuroscience bulletin 33, 73–84 (2017).
[9] Gattuso J. J., Perkins D., Ruffell S., Lawrence A. J., Hoyer D., Jacobson L. H., Timmermann C., Castle D., Rossell S. L., Downey L. A., Pagni B. A., Galvão-Coelho N. L., Nutt D., Sarris J.: Default Mode Network Modulation by Psychedelics: A Systematic Review. The international journal of neuropsychopharmacology 26, 155–188 (2023).
[10] Thomas K., Malcolm B., Lastra D.: Psilocybin-Assisted Therapy: A Review of a Novel Treatment for Psychiatric Disorders. Journal of psychoactive drugs 49, 446–455 (2017).
Abbildungsquellen
Graner, John; Oakes, Terrence R.; French, Louis M.; Riedy, Gerard (2013): Functional MRI in the investigation of blast-related traumatic brain injury. In: Frontiers in neurology 4, S. 16. DOI: 10.3389/fneur.2013.00016.
Yeo, B. T. Thomas; Krienen, Fenna M.; Sepulcre, Jorge; Sabuncu, Mert R.; Lashkari, Danial; Hollinshead, Marisa et al. (2011): The organization of the human cerebral cortex estimated by intrinsic functional connectivity. In: Journal of neurophysiology 106 (3), S. 1125–1165. DOI: 10.1152/jn.00338.2011.
[Nota. - Vielleicht ist das Mysterium der Reflexion im Wechselspiel von Default mode und Vorstellungstätigkeit zu suchen? JE]
 Hafis aus Philosophierungen
Hafis aus Philosophierungen




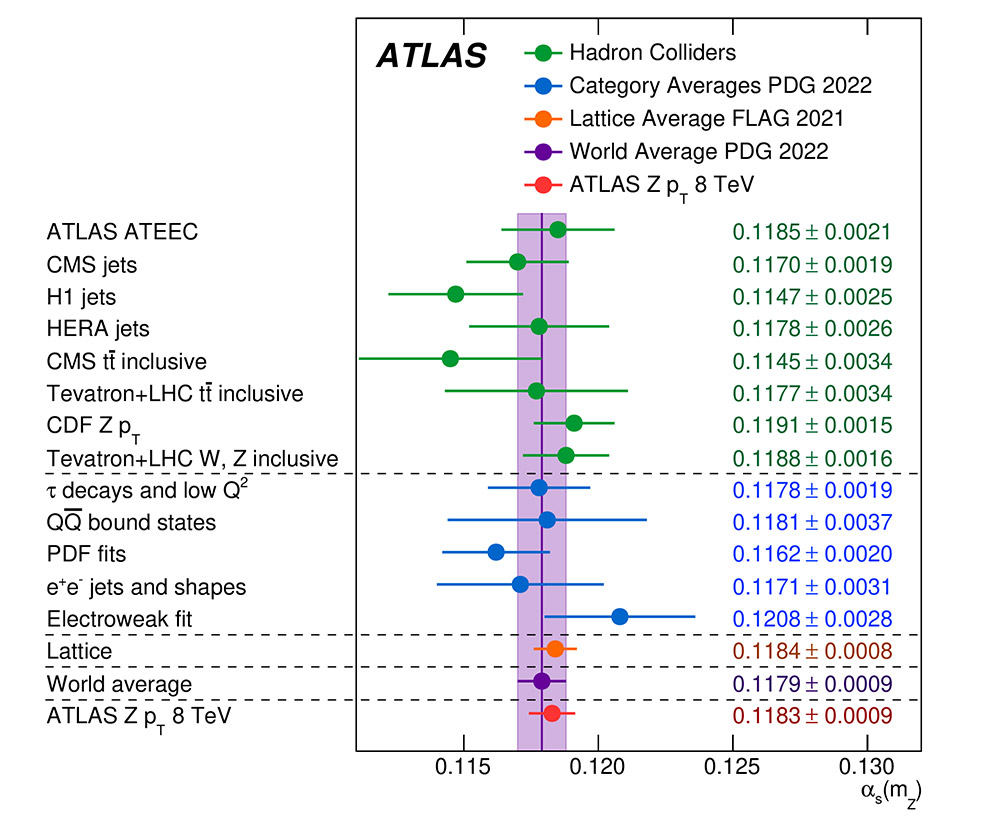







 zu
zu 




