
aus scinexx.de, 23. 10. 2025 zu Jochen Ebmeiers Realien
Rätsel um die Gravitation vertieft sich
Experimente zum Nachweis der Quantengravitation können irreführen
Fundamentale Lücke: Schon Einstein scheiterte daran, Gravitation und Quantenphysik zu vereinen. Jetzt haben Physiker entdeckt, dass auch der vielversprechendste Test auf eine Quantelung der Gravitation nicht eindeutig ist. Der Grund: Auch in einer rein klassischen, ungequantelten Raumzeit kann es eine Art Verschränkung von Massen geben, wie die Forscher in „Nature“ demonstrieren. Doch genau diese Verschränkung galt bisher als experimenteller Beweis für die Quantennatur der Gravitation. Und jetzt?
Die Gravitation ist der Außenseiter unter den vier Grundkräften – und eines der größten Rätsel der Physik. Zwar revolutionierte Albert Einstein unsere Sicht auf die Gravitation durch sein Raumzeit-Modell. Doch auch er scheiterte an einem entscheidenden Punkt: Während alle anderen Grundkräfte durch Trägerteilchen vermittelt werden – Gluonen bei der Starken, W- und Z-Bosonen bei der Schwachen Kernkraft und Photonen beim Elektromagnetismus –, fehlt ein solches Vermittlerteilchen für die Gravitation. Bisher ist nicht einmal klar, ob es überhaupt „Gravitonen“ gibt.
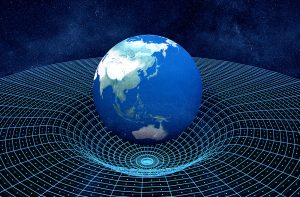
Ist die Gravitation gequantelt?
Das hat Folgen: Alle anderen Grundkräfte sind durch den Austausch diskreter Teilchen quantisiert – sie lassen sich daher auch über die Quantenmechanik beschreiben. Nicht so die Gravitation: Einsteins Relativitätstheorie ermöglicht es zwar, die Gravitation mit den Mitteln der klassischen Physik zu beschreiben. Mit der Quantenphysik ist dies aber nicht vereinbar. Es gibt theoretische Ansätze, die diese Quadratur des Kreises versuchen, darunter die Schleifen-Quantengravitation, die String-Theorie oder auch die Idee einer superfluiden Raumzeit.
Doch bisher scheiterten alle Modelle an einem entscheidenden Punkt: Es fehlen experimentelle Belege dazu, ob die Raumzeit gequantelt ist oder nicht. Bisherige Tests blieben uneindeutig. „Die Vereinheitlichung von Gravitation und Quantenmechanik bleibt eine der grundlegendsten offenen Fragen der Physik“, erklären Joseph Aziz und Richard Howl von der University of London.
Es gibt aber ein Experiment, das vielleicht endlich eine Antwort liefern könnte. Vorgeschlagen wurde es bereits 1957 vom US-Physiker Richard Feynman. In diesem Experiment bringt man ein möglichst schweres, dichtes Objekt in eine quantenphysikalische Überlagerung und lässt es dann mit einem zweiten Objekt interagieren. Ist die Gravitation gequantelt, müssten sich beide Objekte auch miteinander verschränken lassen. „Dies galt bisher als eindeutiger Beweis dafür, dass die Gravitation den Gesetzen der Quantenmechanik folgt“, erklären die Physiker.
Der Grund: Gängiger Theorie nach kann es in der klassischen Physik keine „spukhafte Fernwirkung“ geben. Denn für die Verschränkung ist ein nicht-lokaler Informationsaustausch zwischen den verschränkten Objekten nötig – beispielsweise durch gequantelte Trägerteilchen. Weist das Experiment eine Verschränkung nach, muss es demnach Gravitonen und damit eine Quantisierung der Gravitation geben – so die Annahme.
Genau diese Annahme widerlegen Aziz und Howl nun jedoch. „Wir zeigen, dass auch lokale, klassische Theorien der Gravitation eine Quantenkommunikation und damit eine Verschränkung erzeugen können“, schreiben sie. Basis ihrer Argumentation ist die Quantenfeldtheorie (QFT). Nach dieser sind physikalische Felder und ihre jedem Punkt zugeordneten Werte die Grundeinheiten, die alle Teilchen hervorbringen. Ein Beispiel dafür ist das Higgs-Boson, das sich auch als Manifestation des Higgs-Felds beschreiben lässt.
Wie die beiden Physiker erklären, gilt die Quantenfeldtherorie auch für Materie. In einem solchen Materiefeld können auch virtuelle Teilchen entstehen – nicht direkt beobachtbare Zwischenzustände von Wechselwirkungen. „Auf der Ebene der Feldtheorie gibt es demnach auch den Austausch virtueller Materieteilchen zwischen Massen“, erklären Aziz und Howl. Daraus wiederum folgt, dass es auch ohne Gravitonen einen nichtlokalen Informationsaustausch geben kann – und damit eine Verschränkung.

Ablesbar nur an subtilen Unterschieden
„Die bloße Beobachtung einer Verschränkung im Feynmannschen Experiment kann daher nicht als Beweis für eine gequantelte Gravitation gelten“, schreiben die Physiker. Denn auch eine klassische Gravitation kann eine Art Verschränkung zwischen den Massen erzeugen – selbst wenn es keine gequantelten Gravitonen gibt. Daher kommt es auf die Parameter und die Art des Experiments an, ob die beobachtete Verschränkung eine Quantengravitation anzeigt oder nicht.
Was aber bedeutet dies konkret für die experimentelle Überprüfung? Das rechnen die beiden Forscher in ihrer Studie vor. Ihren Ergebnissen nach gibt es demnach Unterschiede in der Abhängigkeit der Verschränkung von Masse, Abstand und Wechselwirkung. Der Einfluss dieser Parameter ist bei der klassischen, nicht gequantelten Gravitation etwas anders als bei der Quantengravitation.
„Dies hat direkte Konsequenzen für zukünftige Experimente, die die Quantennatur der Gravitation über die Verschränkung testen wollen“, sagt der nicht an der Studie beteiligte Physiker Zachary Weller-Davies von InstaDeep London. So können Forschende die neuen Erkenntnisse nun nutzen, um die Experimentparameter so anzupassen, dass die irreführende Verschränkung durch klassische Effekte minimiert wird.
„Die Analyse von Aziz und Howl macht klar, dass künftige Experimente sowohl die Stärke als auch das Skalierungsverhalten der Verschränkung messen und dies dann mit den Vorhersagen der klassischen Physik und der Quantentheorien vergleichen müssen“, erklärt Weller-Davies. „Solche Experimente sind aber eine enorme Herausforderung, weil sie eine präzise Kontrolle über Quantenzustände über mehrere Größenskalen hinweg erfordern.“ (Nature, 2025; doi: 10.1038/s41586-025-09595-7)
Quelle: Nature; 23. Oktober 2025 - von Nadja Podbregar


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen