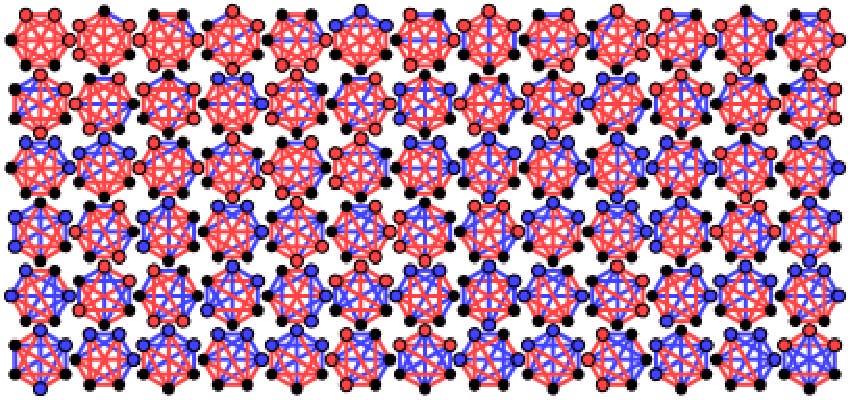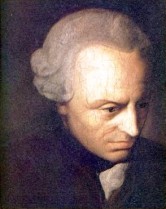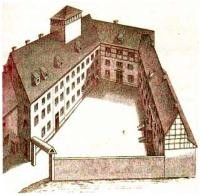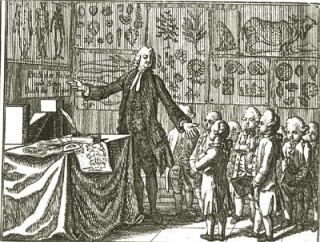Gesetz aus Jochen Ebmeiers Realien
Gesetz aus Jochen Ebmeiers RealienAch, das ist aber schön, Frau Traxler, dass Sie uns diese liebe alte Bekannte auch einmal wieder aufwärmen! Sie würde sonst womöglich noch erfrieren. Gut auch, dass Sie keine halben Sachen machen, sondern voll aufs Ganze gehen und Ihren Beitrag abschließend damit eröffnen, "dass die Wissenschaft zum Schluss kommt: Den freien Willen gibt es nicht." Gut, dass Sie uns gar nicht erst auf dumme Ge-danken kommen lassen.
In der Publizistik geht das. Doch in der Wissenschaft würde man das eine Petitio principii nennen, und das geht nicht: Sie unterstellen stillschweigend, dass Wissen-schaft Natur wissenschaft ist, und versichern uns, "die Idee vom freien Willen ist nicht kompatibel mit dem, was wir in der Natur sehen". Dass aber "die Wissenschaft eindeutig zeigt, dass wir keinen freien Willen besitzen", schließen Sie daraus ganz zu Unrecht. Die Naturwissenschaft zeigt eindeutig, dass in der Natur kein freier Wille vorkommt. Das behauptet aber auch keiner. Doch Sie unterstellen, dass es außer der Naturwissenschaft... keine Wissenschaft gäbe. Wie kommen Sie denn darauf? Wenn es einen freien Willen gäbe (schließen Sie's nicht gleich aus, sondern nehmen Sie's der methodischen Sauberkeit halber probeweise mal an), dann wäre er keine Tatsache der Natur, sondern eine Tat des Geistes.
Dass es einen Geist nicht gebe, könnten Sie nur behaupten, wenn es keine Geistes-wissenschaften gäbe. Dass sie keine Wissenschaften sind, können Sie nicht auf ihre Kappe nehmen, denn in unserer Geschichte waren sie früher da als die Naturwis-senschaft und haben sie überhaupt erst möglich gemacht. Bestreiten könnten Sie allenfalls, dass sie mit dem Ausdruck 'Geistes' wissenschaften ihren Gegenstand genau genug bestimmt hätten.
Damit stünden Sie nicht allein. Das hat schon vor über hundert Jahren einer ihrer namhaften Vertreter selbst getan. Wilhelm Windelband hat die Unterscheidung in idiographische und nomothetische Wissenschaften vorgeschlagen, womit er auf eine metaphysische (und daher dogmatische) Eingangsdefinition verzichten konnte: die eine beschreibt einen einzigen, individuellen Gegenstand oder Sachverhalt nach all seinen denkbaren Seiten hin; das tun alle historisch orientierten Fächer, die er darum idiographisch nennt. Die andere sucht, in der Mannigfaltigkeit der Erschei-nungen Übereinstimmungen und Gesetze festzustellen. Er nennt sie daher nomo-thetisch.
Und siehe da: 'Natur' ergibt sich unter dieser Voraussetzung als das Feld, wo Ge-setze gelten. Der Mensch gehört zur Natur, er kann ihren Gesetzen nicht entwei-chen, stimmts? Nein, Frau Traxler; man kann den Menschen so betrachten, als ob er einem Reich von Gesetzen angehörte oder, um mit Ihrer Sprache zu reden, als ob er "nur ein Naturwesen" sei. Und unter dieser Prämisse werden Sie nie in die Verlegenheit geraten, über einen freien Willen zu stolpern. Doch in jeder irgendwie historischen Betrachtung werden sie den Menschen als ein unberechenbares, mut-williges, leichtsinniges und furchtsames Geschöpf vorfinden, dessen Tun und Las-sen selbst skrupellose Geister wie Hegel und seine stalinistischen Acolyten nicht in eine Linie zwingen konnten (und in schwierigen Momenten die Dialektik beschwö-ren mussten).
Sie meinen, Systemik wäre das Mauseloch, durch das Sie mir entkommen? Die systemische Betrachtung kann immer nur beobachten, dass dieser Zustand vorher und jener nachher war. Wie und warum oder auch nur wann der eine auf den oder gar aus dem andern folgte, behauptet sie ja gerade nicht zu wissen. Und wenn Sie, Frau Traxler, sich nicht so auf Physik versteift und auch ein wenig um Philosophie bemüht hätten, wären Sie unterm Stichwort Kant auf den Namen Hume gestoßen und wären der Frau Hossenfelder nicht auf den Leim gegangen.
Kommentar zu Freier Wille in einem deterministischen Universum?, JE, 12. 4. 23